Der harte Preiswettbewerb der Fahrschulen untereinander und die Frage, was die Verbände für die Fahrlehrer tun, begleiten die Fahrlehrer schon 60 Jahre lang. Das zeigt der Blick in die Sammelbände der "Fahrschule", die im Jahr 2010 ihr 60-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Beinahe so lange, nämlich seit 1951, ist die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände (BVF) ihr Herausgeber und nimmt an dem, was in der Zeitschrift publiziert wird, seit jeher regen Anteil. So durchzieht die aktive Arbeit der in der BVF organisierten Landesverbände die vielen Hefte, die im Laufe der Jahre immer wieder ihr Gesicht gewechselt haben und farbiger geworden sind, ergänzt durch einen Internet-Auftritt. Die Redaktion hat die wichtigsten Informationen aus den Jahren 1950 bis 2009 gegliedert nach Jahrzehnten zusammengestellt. Außer den direkt am Bildschirm lesbaren Dateien steht unterhalb des gewählten Jahrzehnts immer ein Download-Kasten, über den man sechs pdf-Dateien herunterladen kann. Jede von ihnen steht für ein Jahrzehnt Fahrschul-Geschichte.
- FS_Geschichte50er (197.9 KB, PDF)
- FS_Geschichte60er (201.4 KB, PDF)
- FS-Geschichte70er (171.9 KB, PDF)
- FS-Geschichte80er (160.9 KB, PDF)
- FS-Geschichte90er (142.0 KB, PDF)
- FS-Geschichte00er (301.1 KB, PDF)

Die Jahrgänge 1950 bis 1959
60 Jahre „Fahrschule“ Das ist in den ersten 60 Jahren passiert Teil 1: Die 50er-Jahre Zusammengestellt von Dietmar Fund Wie ein Blick in die alten Sammelbände der 1950 gegründeten „Fahrschule“ (kurz: FS) zeigt, beschäftigen einige Themen die Fahrlehrer nun schon mehr als 60 Jahre lang – allen voran das Thema Preiswettbewerb. Außerdem sind die Hefte eine Fundgrube für wichtige verbandspolitische Weichenstellungen, aber auch für heute skurril anmutende Berichte und Anzeigen. Jahrgang 1950 Ist die Fahrlehrertätigkeit ein Gewerbe oder ein freier Beruf? Das fragt sich schon 1950 der Münchener Rechtsanwalt Hermann Jaeger. Resümee: Der Fahrlehrerberuf ist ein freier Beruf. Im Kreis der freien Berufe liegt er allerdings da, wo der Weg zum Gewerbe hinführt. (FS 3/50, S. 2) Jeder 82. Deutsche besitzt ein Auto. (FS 3/50, S. 4) „Ein guter Fahrunterricht und eine gründliche Verkehrserziehung kann nur von Fahrlehrern ausgehen, die über verkehrssichere Fahrzeuge und ausreichendes Lehrmaterial verfügen. (...) Wer von den vier Rädern seines Schulwagens nur noch drei bezahlen kann und vor lauter Schulden nicht weiß, wie er morgen seine Steuern, seine Garagenmiete und seine sonstigen Unkosten bestreitet, der kann sich selbst bei gutem Willen nicht so in den Dienst der öffentlichen Verkehrserziehung stellen, wie es wünschenswert ist.“ So heißt es in der Antwort auf einen Leserbrief, der „Kundenfahrschulen“ von Autohäusern verteidigt. (FS 3/50, S. 9) Ford wirbt für Austauschmotoren. Sie kosten 390, 460 oder 690 Mark. (FS 3/50, U4) Bundesverkehrsminister Dr. Hans-Christoph Seebohm empfing am 12. April 1950 eine Abordnung der Arbeitsgemeinschaft der westdeutschen Fahrschulverbände. Die Vertreter Ludwig Sporer, Bleissem und Leiser sowie ihr Rechtsanwalt Hermann Jaeger trugen vor, dass eine noch größere Überfüllung des Fahrlehrerberufes unter allen Umständen vermieden werden müsse. „Eine weitere Vermehrung der Ausbildungsstellen würde den völligen Ruin der Kraftfahrschulen und dadurch bedingte katastrophale Auswirkungen auf die öffentliche Verkehrssicherheit zur Folge haben“, heißt es in FS 5/50, S. 1. Seebohm erkannte an, dass die Fahrlehrerprüfungen erschwert und die Anforderungen an die Ausstattung verschärft werden müssten. FS 5/50 meldet auf Seite 12, dass der Verband der Kraftfahrlehrer Südbaden und ein eigener Fachverband der Kraftfahrlehrer nun auch in Württemberg-Hohenzollern gegründet worden seien. „Über die periodische Nachuntersuchung von Kraftfahrzeugführern“ sinnierte in FS 6/50, S. 1 der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Arndt. FS 6/50 stellt auf Seite 10 den pannensicheren Continental-PS-Schlauch vor. „Aktuelle Probleme des Fahrlehrerberufes“ besprach die Versammlung der Kraftfahrlehrer des Regierungsbezirks Köln, schon damals in der Flora. (FS 6/50, S. 11) „Das größte Unfallübel: Zu schnelles Fahren“ hieß der Untertitel eines Artikels in FS 7/50, S. 3, der sich mit den „Hauptsünden im Straßenverkehr“ beschäftigte. Auf der Mitgliederversammlung des Landesverbandes Bayerischer Kraftfahrschulen wurde Dipl.-Ing. Ludwig Sporer einstimmig für weitere drei Jahre als Vorsitzender bestätigt. Er appellierte an die Landesbehörden, eine „zu große Überfüllung des Fahrlehrerberufes und eine weitere Vermehrung der Ausbildungsstellen“ zu verhindern. (FS 7/50, S. 12) „Was frisst ein Bombierwolf?“ frägt Dunlop in einer Anzeige in FS 8/50, U2. Gemeint ist eine Maschine, die in der Reifenproduktion verwendet wird. „Zur Hebung der Fahrschulen“ schreibt in FS 8/50, S.3 Verleger Heinrich Vogel. Nach seiner Schilderung finden Fahrschüler vielfach statt eines Schulungsraums ein Wohnzimmer mit nur wenig Lehrmaterial und „primitiven Sitzgelegenheiten“ vor. „Es müsste auch in Deutschland wieder möglich werden, das Niveau der Ausbildung zu heben“, schreibt Vogel nach einem Exkurs zu Schweizer Fahrschulen. Weiter: „Das gegenseitige Unterbieten der Ausbildungspreise birgt eine große Gefahr für den Berufsstand in sich. Eine weitere Zulassung neuer Fahrlehrer führte das gesamte Fahrlehrergewerbe zum Ruin. Die Ansicht ist irrig, dass zusätzliche Fahrlehrer auch zusätzliche Fahrschüler bedeuten“, schreibt der Verleger, der damals noch Degener-Produkte vertrieben hat. Der Verkehrsminister des Landes Nordrhein-Westfalen lobt „Fahrschule“ als „Fachzeitschrift beachtlichen Formats“. Sie hatte damals zwölf Seiten plus Umschlag. (FS 8/50, S. 10) In Württemberg-Baden gründen die Fahrlehrer auf Inititative des Ulmer Fahrlehrers Karl Rederer einen eigenen Fachverband, zu dessen 1. Vorsitzenden Hermann Horlacher gewählt wird. (FS 8/50, S. 12) „Was tut der Verband für mich?“ fragte schon in FS 9/50, S. 3 Dr. Werner Bohse aus Köln. Er schließt mit den Worten: „Es sollte nicht die Frage gestellt werden, was tut der Verband, sondern was tue ich für den Verband.“ Mit dem Slogan „Noch schneller fahren ... noch sicherer fahren ...“ wirbt die Daimler-Benz Aktiengesellschaft für den Typ 170 D (FS 10/50, U2). Der Wagen hatte eine Höchstgeschwindigkeit von „116 km/std“ und verbrauchte 9,7 Liter auf 100 Kilometer. Sein Preis: 8.620 Mark. Am 19.8.50 gab das Bundesverkehrsministerium neue Richtlinien für die Erteilung einer Ausbildungserlaubnis heraus. Vorgesehen sind nun eine mündliche, schriftliche und fahrpraktische Prüfung, ein mindestens 18 Quadratmeter großer und heller Unterrichtsraum, „der unmittelbaren Zugang, ausreichende Sitzgelegenheit und Schreibmöglichkeit“ hat. Auch Lehrfahrzeuge, Lehrmodelle, Unterrichtstafeln und der Besitz des Verkehrsblatts, von Lehrbüchern und einer fachtechnischen Zeitschrift werden vorgeschrieben. (FS 10/50, S. 3) Eine biegsame Windschutzscheibe solle Scheibenwischer entbehrlich machen, berichtete FS 10/50, S. 4. Auf Seite 6 wurde eine Kaffeemaschine im Kraftfahrzeug vorgestellt. Am 19.9.59 wurde auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen eine Arbeitsgemeinschaft der Landesverkehrswachten gegründet. Sie war als Vorläufer einer Bundesverkehrswacht gedacht. (FS 10/50, S. 8) „Männer in führender Position (...) sind heute allgemein über Gebühr beansprucht. Die Vielfalt ihrer Aufgaben zwingt immer wieder zu weiten Reisen, die nur im Kraftwagen zeitgerecht geschafft werden können. (...) Sich ausruhen, schlafen können auf solchen langen Fahrten: Das ist der Wunsch der Vielbeanspruchten. Jetzt können Sie es!“ jubelte FS 10/50 auf Seite 11. Vorgestellt wurde ein „Ruhesitz“, der die „unvergleichliche Federung“ der Mercedes-Benz-Fahrzeuge ergänzen sollte. „Was kosten uns die Verkehrsunfälle?“ und „Gehen unsere Ölreserven zur Neige?“ fragte FS 11/50 auf Seite 5 und 6. Im gleichen Heft wird geschildert, wie man Schäden an der Druckluftbremse behebt. Der Verband der Kraftfahrlehrer Südwürttemberg-Hohenzollern beschließt am 21.10.50, seine Organisation aufzulösen und dem jungen Verband der Kraftfahrlehrer Württemberg-Baden beizutreten. FS 12/50 meldet auf Seite 11, dass sich am 11.11.50 der Verband der Kraftfahrlehrer in Südbaden den bereits vereinten Nachbarverbänden angeschlossen hat. In Hannover stirbt der Verleger Werner Degener im Alter von nur 42 Jahren. (FS 12/50, S. 12) Jahrgang 1951 Im Jahresrückblick auf 1950 (FS 1/51, S. 1) stellt Rechtsanwalt Hermann Jaeger fest, dass sich die Verbände Anfang 1950 gerade zur Arbeitsgemeinschaft der Westdeutschen Fahrschulverbände zusammengeschlossen hätten. Die schwierigen Vorarbeiten dazu seien insbesondere von Bayern geleistet worden. Jaeger lobt, dass es Hermann Horlacher in Baden-Württemberg gelungen war, einen „großen und einheitlichen Verband für Baden, Württemberg und Hohenzollern“ zusammenzuschließen. Als Erfolg wertet der Rechtsanwalt auch, dass die „Fahrschule“als eigene Fachzeitschrift gegründet worden sei. Deren Herausgeber ist und bleibt Heinrich Vogel alleine, der gerade den Umzug in die Kreuzstraße meldet. Am 17./18.3.51 wird die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände e. V. gegründet. Als 1. Vorsitzender wurde „mit großer Mehrheit“ der bayerische Landesvorsitzende Ludwig Sporer gewählt. Zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden bestimmte die Versammlung Johannes Tevs aus Kiel, 2. stellvertretender Vorsitzender wurde Hermann Horlacher, 1. Vorsitzender der Baden-Württemberger. Als wesentliche Ziele der Bundesvereinigung wurden die Verkehrserziehung des Kraftfah¬rernachwuchses und die Pflege der Verkehrssicherheit bestimmt. Der Verband wollte keine Einzelmitglieder aufnehmen, sondern nur Landesverbände, die die örtlichen Verhältnisse besser beurteilen könnten. Die „Fahschule“ wurde einstimmig zum offiziellen Verbandsorgan erklärt. (FS 3/51, S. 1) Hermann Horlacher wirbt für die Gründung eines eigenen Versicherungsvereins, an dem Fahrlehrer für 200 Mark Anteile erwerben können. Grundgedanke: Fahrlehrer sind ein gutes Risiko und bezahlen deshalb bei normalen Versicherungen zu hohe Prämien. (FS 3/51, S. 2) FS 4/51, S. 10 wagt einen Blick auf die Fahrausbildung in den USA. Hermann Horlacher kündigt in FS 5/51, S. 10 eine „Versammlungsreise“ zu den Verbänden an. Er hatte offenbar Mühe, den erforderlichen Gründungsstock für die Fahrlehrerversicherung zusammenzubringen. Er nennt folgende Verbände: * Koblenz-Montaubaur-Rheinhessen und ¬Trier, * Nordrhein, * Westfalen, * Bremen, * Hamburg, * Kiel (Schleswig-Holstein) * Niedersachsen, * Hessen, * Pfalz und * Bayern. In Baden-Württemberg lagen ja die Wurzeln des neuen Versicherungsvereins. „Die Konkurrenzklausel im Fahrlehrerberuf“ beschäftigte schon Hans Waiß in FS 6/51, S. 3. Vorbildliche Unterrichtsräume gab es in FS 6/51, S. 9 zu sehen. Es war damals offensichtlich noch Frontalunterricht angesagt. Als „praktische Neuerung“ kündigte FS 6/51, S. 10 den „Schulungsapparat“ des Mechanikermeisters Max Haas an – offenbar die erste Doppelpedalerie. Es gab ihn mit einem Pedal nur für die Kupplung (35 Mark) oder mit allen drei Pedalen (75 Mark). Haas warb im selben Heft als Fahrschule aus Nordendorf bei Donauwörth für seinen Kupplungsapparat. Der Landesverband Bayerischer Kraftfahrschulen fordert erneut, den Berufszugang wieder „von der Feststellung eines Bedürfnisses“ abhängig zu machen. (FS 6/51, S. 11) Die Umschreibung von Wehrmacht-Fahrlehrerscheinen ist das Thema von Hans Waiß in FS 7/51, S. 1. Ein Karlsruher Fahrlehrer namens Jung setzte sich in FS 7/51, S. 12 mit Weiterbildungs- und Pannenkursen für Kraftfahrer auseinander. Sein Fazit: „Wie kaum ein anderes Mittel können diese bei guter Durchführung geeignet sein, (...) wertvolles Volksvermögen zu erhalten, die Betriebskosten des Einzelnen zu senken und gleichzeitig das Ansehen unseres Berufsstandes in der Öffentlichkeit zu heben“. Mit der Frage „Sind Sie magenempfindlich?“ warb ein Arzneimittelhersteller im gleichen Heft für Antisodit. Einen Dauerbrenner behandelte Hans Waiß erstmals in FS 8/51, S. 2: Wettbewerbsfragen im Fahrschulwesen. Er greift insbesondere „Zugabeschleuderer“ an. „Mit der Frage der Preisherabsetzungen ist das unerfreulichste Kapitel des heutigen Wettbewerbs der Fahrschulen angeschnitten“, fährt der Autor fort. Sein Resümee: „Es wird höchste Zeit zur Selbstbesinnung und Selbstdisziplin, wenn der Fahrlehrerstand sich nicht durch eigene Schuld zum sicheren Ruin führen und damit seine berufliche Stellung überhaupt gefährden will“. Wie man in Frankreich Autofahren lernt, behandelt FS 8/51, S. 4. Darin steht beispielsweise der schöne Satz: „Auf Alkoholgenuss reagiert ja der Franzose, der praktisch immer unter Alkoholeinfluss steht, nicht so impulsiv wie wir Deutschen.“ „Zeichnet den Gründungsstock!“ So appellierte Hermann Horlacher erneut in Sachen Fahrlehrerversicherung. (FS 8/51, S. 7) „Psychologie für den Fahrlehrer“ entdeckten der Fahrlehrer Karl Seitz sen. und sein gleichnamiger Sohn, ein Psychologe, erstmals für FS 8/51, S. 11. Karl Lidl taucht erstmals im Impressum von FS 8/51 auf, und zwar unter „Schriftleitung und verantwortlich für den Inhalt“. In FS 9/51, S. 2 führt er sich mit dem Artikel „Problematik des Winkers“ als Autor ein. Der Essener Fahrlehrer Alfred Hilleke darf in FS 9/51, S. 9 seine Unterrichtsräume zeigen. In FS 10/51, S. 9 sind weitere drei Kollegen dran, ebenso in FS 11/51, S. 6. Heinrich Vogel, die Landes- und die Bundesverkehrswacht veranstalteten am 26.10.51 einen Trauerzug durch die Münchener Innenstadt, um auf die 217 Verkehrstoten hinzuweisen, die 1950 in München verzeichnet worden waren. (FS 11/51, S. 3) „Die weibliche Psyche im Zusammenhang mit dem Kraftfahrzeug“ untersuchte Schriftleiter Karl Lidl in FS 11/51, S. 4. Er lobte den größeren Fleiß und die Gewissenhaftigkeit der Fahrschülerinnen. „Wir sehen also, dass die Frau ihrer Natur nach für das Lenken eines Kraftfahrzeugs durchaus gut geeignet ist“, stellt Lidl fest. „Hydraulische Bremsen nun auch für Motorräder“ lautet der erste Beitrag, der sich mit Zweirädern befasst. (FS 11/51, S. 9) FS 12/51, S. 1 berichtete über die Vorstandssitzung der Bundesvereinigung. Als „Existenzfrage“ wurde dort die Bedürfnisprüfung diskutiert, die der Dachverband gerne gehabt hätte. Den Film als Unterrichtsmittel entdeckt FS 12/51, S. 12. „Die Erfahrung lehrt auch, dass diejenigen Fahrschulen, welche Lehrfilme bevorzugen, von den Fahrschülern bevorzugt werden“, schreibt Karl Lidl euphorisch. Schließlich geht es in dem Beitrag auch um Filme, die Vogel als Vertriebspartner von Degener vertreibt. Der bewirbt auf der U4 Farbdias als anschaulichste Lehrmittel für den Fahrschulunterricht. Jahrgang 1952 In der Rückschau zu Beginn von FS 1/52 schreibt Rechtsanwalt Hermann Jaeger: „Zu großer Optimismus und mangelnde Selbstkritik bedeuten für eine Bundesvereinigung eine ernste Gefahr.“ Er lässt durchblicken, dass seit der Gründung der Bundesvereinigung einige Landesverbände unter Zugzwang stehen: Sie müssen schauen, dass sie an den Erfolgen von Nachbarverbänden Anteil nehmen können. FS 2/52 liegt ein DIN A6-Zettelchen bei, das ankündigt, der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit der Kraftfahrlehrer im Bundesgebiet habe seinen Geschäftsbetrieb am 24.1.1952 aufgenommen und nehme ab sofort Versicherungs-Anträge entgegen. In FS 2/52, S. 5 wird über die Neugründung berichtet. Demnach wurde ein neunköpfiger Aufsichtsrat gewählt. Zum Vorsitzenden des Vorstandes bestimmte der Aufsichtsrat Hermann Horlacher, baden-württembergischer Verbandsvorsitzender und Motor des neuen Unternehmens. Die „Fahrschule“ wurde als offizielles Organ des Vereins bestimmt. FS 2/52, S. 6 stellt ein Lehrgerät des Augsburger Fahrlehrers ??? Ziegler vor, mit dem man im Stand Schalten und Lenken üben kann. Das Gerät ließ sich sogar mit einem Filmprojektor koppeln. Karl Lidl stellt in FS 2/52, S. 8 den Ford Taunus 12 M vor. Er wog 825 Kilogramm und kostete mit 38 PS 7.350 Mark. Sogar eine Behr-Klimaanlage gab es schon, und zwar für 185 Mark. In FS 3/52 (U2) warb Ford anhand von 79 Vorzügen für dieses Modell. Die ersten Lehrbücher für Motorräder werden in den Heften 1 und 2/52 beworben (U4). Die Serie „Vorbildliche Unterrichtsräume“ wird in FS 3/52, S. 9 fortgesetzt mit zwei Beispielen aus Haßfurt und Esslingen. Zu sehen sind auch Klappbestuhlungen. Die bewirbt beispielsweise die Westdeutsche Sitzmöbelfabrik in Bad Oeynhausen in FS 4/52. Die Ausbildung von Kraftwagenführern in Schweden beleuchtete FS 4/52, S. 4. „Bundesvereinigung erörtert Berufsfragen“ heißt es auf Seite 1 der FS 5/52. Ludwig Sporer wurde einstimmig im Amt bestätigt. Auch seine Stellvertreter blieben im Amt. Syndikus Hermann Jaeger berichtete, die Bundesvereinigung bemühe sich um die Genehmigung von Fest- oder Mindestpreisen und wolle die Bedürfnisfrage weiterhin stellen. Mit „Wanderfahrschulen“ setzten sich der bayerische und der Pfälzer Landesverband bei ihren Mitgliederversammlung auseinander. Darunter wurden nicht nur tatsächlich von Ort zu Ort wandernde Fahrlehrer verstanden, sondern auch Zweigstellen im heutigen Sinne, gegen die bei Bedarf keine Bedenken bestünden. (FS 5/52, S. 14) Wie der Bericht über die Jahresversammlung der Kraftfahrlehrer Württemberg-Baden-Hohenzollern in FS 5/52, S. 15 zeigt, gehörten damals schon die gleichen Elemente zu den Mitgliederversammlungen: Grußworte von Ministerium, TÜV, anderen Landesverbänden und der Bundesvereinigung gab es ebenso wie die Ehrung von Mitgliedern. Den ersten Übersichtsbericht über Motorräder brachte FS 6/52, S. 10. Der Unterbezirk Bergisch-Land hatte 1952 zum ersten „Gedankenaustausch der europäischen Fahrlehrer“ eingeladen, so der Titel des Artikels in FS 7/52, S. 3. Auf Antrag ihres Schweizer Kollegen Frei beschlossen die Delegierten der acht vertretenen Staaten, eine „Dachorganisation der intereuropäischen Fahrlehrer“ zu gründen. BMW-Motorräder präsentierte FS 7/52, S.8. „Um den Führerschein der Klasse 4“ geht es in einem Referat des baden-württembergischen Ministerialrats Wilhelm, das FS 8/52, S. 5 abdruckte. Der Berufsstand kämpfte damals gegen diese Führerscheinklasse. Über Leuchtfolien, die Fahrzeuge nachts besser kenntlich machen sollten, berichtete FS 8/52, S. 6. „Doppelpedale oder nicht?“ fragte FS 8/52, S. 9. Der nicht genannte Autor sprach sich dafür aus, Doppelpedale in Fahrschulautos gesetzlich vorzuschreiben. Dabei wusste er den baden-württembergischen Verbandsvorsitzenden Hermann Horlacher und den Syndikus der Bundesvereinigung auf seiner Seite. Gleich daneben wurden die „Hilfspedale“ des Künzelsauer Fahrlehrers Wilhelm Veigel erstmals beschrieben. Veigel inserierte im Heft mit Aggregaten, die zwischen 137,50 und 181,25 Mark kosteten. Zündapp-Motorräder präsentiert FS 8/52, S. 10. Die Motorräder von Auto-Union-DKW waren in FS 9/52, S. 8 an der Reihe, die Adler-Werke in FS 10/52, S. 11. Das Verhältnis von Fahrlehrern und Verkehrswachten beleuchtete FS 10/52, S. 3. Fahrlehrer sollten die Verkehrswachten unterstützen, war die Leitlinie des Artikels. Karl Lidl berichtet in FS 10/52, S. 5 von einer Leserdiskussion über Doppelpedale, die überwiegend von Zustimmung geprägt gewesen sei. Eine „Schrankfahrschule“ präsentierte der Fahrlehrer Ludwig Adelhardt aus Karlstadt am Main. Es handelte sich um einen Lehrmittelschrank, in den man die erforderlichen Modelle nach dem Unterricht schnell verstauen konnte. Angekündigt wurde ein Koffermodell, das vorwiegend für den Unterricht in der Klasse 4 in Behelfsräumen auf dem Lande gedacht sei. (FS 10/52, S. 8, Inserat U3) Dass die „Bundesvereinigung beim Bundesverkehrsministerium“ war, berichtet FS 11/52, S. 3. Bei den drei Ministerialbeamten stieß der Vorstoß für eine Neuordnung des Fahrlehrerwesens offenbar auf Gegenliebe. Weil das Ministerium aber durchblicken ließ, dass es Widerstände in den Ländern gab, appellierte die Bundesvereinigung an die Landesverbände, die entsprechend bei ihren Landesbehörden vorstellig werden sollten. Den guten alten Volkswagen „jetzt mit Synchrongetriebe“ stellte FS 11/52, S. 10 vor. Die Gewerbesteuerpflicht für Fahrschulen griff FS 12/52, S. 2 erneut auf. Die Stellungnahme der Bundesvereinigung sieht den Fahrlehrerberuf als eine unterrichtende und erzieherische Tätigkeit im Sinne des Einkommensteuergesetzes an. Also zähle der Fahrlehrer zu den freien Berufen, wenn er diese Tätigkeit persönlich ausübe. Anders dagegen, wenn er überwiegend auf angestellte Fahrlehrer zurückgreife. Das Fahrschulwesen in Brasilien stellte FS 12/52, S. 5 dar. Gegenüber warb das Amol-Werk Hamburg für Halloo-Wach gegen die Ermüdung am Steuer. Den amerikanischen „Drivotrainer“ stellt FS 12/52, S. 6 vor. Es handelte sich um ein Lehrgerät, vor dem Filme abliefen, die Straßenszenen wiedergaben, auf die der Fahrschüler unter Aufsicht des Fahrlehrers reagieren musste. Ein weiterer Bericht folgt in FS 7/53, S. 9. Jahrgang 1953 Ab FS 1/53 bekommt das Heft ein fotografisches Titelbild, das von Ausgabe zu Ausgabe wechselt, anstelle des gezeichneten, immer gleichen Autos der vorangegangenen Jahrgänge. Leider ist nicht angegeben, ob es sich um Anzeigen handelt. Ein erkennbarer Zusammenhang zu den Artikeln im Heft besteht nicht. „Endlich haben die Fahrlehrer begriffen, dass Kurzausbildung und Preisschleudern den Ruin ihres Berufes bedeuten müssen“, schreibt Syndikus Herman Jaeger in FS 1/53, S. 1 wohl etwas zu optimistisch. Verleger Heinrich Vogel weist auf S. 5 darauf hin, es gehe bei der Fahrausbildung nicht mehr so sehr um das Technische, sondern vielmehr um das Verhalten im Straßenverkehr. „Gut ausgebildete und sichere Fahrer werben besser für eine Fahrschule als marktschreierische Plakate, Preisnachlässe oder oberflächliche Schnellkurse“, schreibt Vogel. Im Mittelpunkt von FS 2/53 steht das Gesetz zur Sicherung des Straßenverkehrs vom 23.1.53. Es sieht unter anderem die Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkungen für Pkw, Krafträder und Omnibusse vor. Das Fahrschulwesen in der Türkei stellt FS 3/53, S. 3 vor, illustriert mit Fotos des Verlegers. In einer Stellungnahme zu einem offenbar kritischen Artikel Richard von Frankenbergs in der ADAC motorwelt schreibt Karl Lidl, es sei nicht richtig, dass sich der Fahrschulunterricht ausschließlich an den Erfordernissen der Prüfung orientiere. Lidl lehnt die Forderung von Frankenbergs ab, die Fahrschüler auch auf die Beherrschung hoher Geschwindigkeiten vorzubereiten. (FS 3/53, S. 4) „Es gibt solche und solche“: Dieses Resümee ergab sich bei einem Erfahrungsaustausch der Technischen Prüfstelle und bayerischer Fahrlehrer in München. Der TÜV reklamierte beispielsweise ein schmutziges Fahrschulfahrzeug, bei dem der Prüfer zwischen Hühnerfutter hatte Platz nehmen müssen. Außerdem kritisierte er faule Fahrlehrer. Glücklicherweise nähmen die meisten Fahrlehrer ihren Beruf aber sehr ernst, lobte der Prüfer abschließend. (FS 3/53, S. 10) „Fahrunterricht an Sonn- und Feiertagen“ ist zwar zulässig, aber unerwünscht, erklärte die Bundesvereinigung in FS 4/53, S. 7. „Ein Fahrlehrer, der seinen Beruf ernst nimmt, kann nicht ohne Schädigung seiner Gesundheit auf eine Erholungspause am Wochenende verzichten“, appelliert der Dachverband. Als Replik auf den kritischen motorwelt-Artikel über die Fahrschulausbildung hat der Hamburger Fahrlehrer Beyer Ideen, die sich als wegweisend erweisen sollten. Er schlägt vor, Fahrlehrer und Fahrschuleinrichtungen sollten auf ihre Eignung geprüft werden, ein strenges Prüfungssoll erbringen und mindestens einmal jährlich zu einem Pflichtlehrgang gehen müssen, bei dem es um pädagogische und psychologische Aspekte gehen müsse. Ferner soll die Neuzulassung eines Fahrlehrers zusätzlich eine einjährige Lehrzeit in einer zugelassenen Fahrschule sowie die Bedürfnisfrage voraussetzen. (FS 4/53, S. 8) Über die Jahreshauptversammlung der Bundesvereinigung in Düsseldorf berichtete FS 6/53, S. 6. Einmal mehr wurde dort bekräftigt, der Dachverband und die Landesverbände sollten sich in Bund und Ländern für die „Wiedereinführung einer Bedürfnisfrage“ einsetzen. Ludwig Sporer wurde als Vorsitzender wiedergewählt, ebenso seine beiden Stellvertreter. „Das Fahrschulwesen im Ausland“ beleuchtete ein Artikel von Rechtsanwalt Hermann Jaeger in FS 6/53, S. 10. FS 8/53 kündigt die Verordnung zur Änderung der StVZO und der StVO an. Wie man das Rückwärtsfahren im Schulungszimmer lernen kann, zeigt FS 8/53, S. 4. Vorgestellt wird eine Vorrichtung, mittels derer ein Fahrschüler ein ferngesteuertes Modellauto von seinem Lenkrad aus lenken kann. Als „unentbehrlichen Helfer jeder fortschrittlichen Fahrschule“ bezeichnet die Augsburger Firma Fries-Arauner ihren „Elektro-Standschalter“. Es war ein Übungsgerät, mit dem man schalten lernen sollte. (FS 8/53, S. 11) Auf derselben Seite steht die Meldung „Schnelles Fahren gesundheitsschädlich“: Ärztliche Untersuchungen, so heißt es darin, hätten ergeben, dass der Autofahrer selbst und auch die Mitfahrenden durch hohe Geschwindigkeiten in der Funktion der Körperorgane tiefgreifend beeinflusst würden. Die Zahl der Pulsschläge steige bei Geschwindigkeiten über 90 Stundenkilometern erheblich. In FS 10/53, S. 2 ist von einem Antrag des Bayerischen Staatsministeriums des Innern die Rede, der die Notwendigkeit eines Fahrlehrergesetzes begründet. Bestehende Fahrschulen sollten eine Konzession ohne Bedürfnisprüfung erhalten, neu zu gründende erst nach einer Bedürfnisprüfung am Sitz des Unternehmens, heißt es darin. Die langjährigen Chefpsychologen der „Fahrschule“, Karl Seitz sen. und Dr. Karl Seitz jun., greifen in FS 10/53, S. 9 ein interessantes neues Thema auf: „Werbepsychologie für Fahrlehrer“. Die Autoren schreiben über Anzeigen- und Kinowerbung sowie über die segensreiche Wirkung eines gepflegten Fahrschulautos und eines pädagogisch sinnvoll aufgebauten Schulungsraums. Den ersten Bericht über die IFMA – es war die zweite – brachte FS 11/53, S. 3. Jahrgang 1954 „Die ständige psychologische Beeinflussung und Erziehung des Fahrschülers während der ganzen Ausbildungsdauer ist mindestens ebenso wichtig wie die Erlernung der rein technischen Beherrschung des Fahrzeuges“, schreibt Verleger Heinrich Vogel in FS 1/54, S. 1. Auch 1954 macht die Bundesvereinigung auf Landesebene Vorstöße für eine Bedürfnisprüfung. Unterstützung sagt Nordrhein-Westfalen zu, das sich beispielsweise Schulfahrten bei Nacht und verschärfte Zulassungsvoraussetzungen für Fahrlehrer vorstellen kann. (FS 12/54, S. 3) Die Serie „vorbildliche Unterrichtsräume“ wird auch 1954 fortgesetzt. Am 8.4.54 wird der Vorsitzende der Bundesvereinigung, Ludwig Sporer, 70. (FS 4/54, S. 9) Der Lüdenscheider Fahrlehrer Alfred Keil schreibt in FS 4/54, S. 13, der Fahrlehrer brauche eine „pädagogische Veranlagung“, die niemand erlernen könne. Sie müsse vorhanden sein. Der Fahrlehrer müsse seine Fahrschüler zu „wirklichen Kameraden der Landstraße“ erziehen. Bei einer „Fortbildungstagung“ in Freiburg sagte ein Bezirksleiter, es sei allerhöchste Zeit zu überlegen, ob der Fahrlehrer fernerhin in Büroräumen, Dachgeschossen und sonstigen Behelfsräumen seinen theoretischen Unterricht wolle oder ob er sich endlich zu dem vorgeschriebenen 20 Quadratmeter großen Unterrichtsraum aufraffen solle. Außerdem fordert der Bezirksleiter die Wiedereinführung des Ausbildungsnachweises. (FS 5/54, S. 15) Während die Zweiradindustrie gegen die Begrenzung der Klasse 4 auf Zweiräder mit maximal 100 Kubik schießt, verteidigt die Bundesvereinigung diesen Ansatz. (FS 5/54, S. 3) „Sturzhelme retten Menschenleben“ heißt es erstmals in FS 5/54, S. 6. „Kraftfahrunterricht in Russland“ war ein Thema in FS 6/54, S. 7. „Pädagogische Anregungen für den Fahrschulunterricht“ wollte Dr. Werner Winkler geben. Er schreibt, dass die erzieherische Seite des Fahrschulunterrichts bei der Ausbildung der Fahrlehrer bisher wenig beachtet worden sei (FS 6/54, S. 9). Am 15.5.54 wählten die bayerischen Fahrlehrer den Ingenieur Spreitzer zum Vorsitzenden. Der bisherige Vorsitzende Ludwig Sporer stellte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl. (FS 6/54, S. 15) Die Bundesvereinigung wählte am 3.6.54 Wilhelm Bramhoff aus Gelsenkirchen zum Nachfolger von Ludwig Sporer. Als 1. Stellvertreter wurde der Kieler Johannes Tevs bestätigt, während zum 2. Stellvertreter der Vorsitzende des Verbandes Nordrhein, Fritz Volkmuth, gewählt wurde. (FS 7/54, S. 3) Einen verkürzten Bremsweg versprach die Pedalkonstruktion eines Solingers. Er kombinierte Gas- und Bremspedal so miteinander, dass man beim Durchdrücken des Gaspedals automatisch bremste. (FS 7/54, S. 7) „Fahr sicher mit Kola Dallmann“ lautet das Motiv einer Anzeige in der gleichen Ausgabe. Die Verkehrsministerkonferenz empfahl am 28.1.54 Sturzhelme, ohne sie vorzuschreiben. (FS 7/54, S. 11) In einer Versammlung der Baden-Württemberger wurde gegen den „Lernführerschein“ gewettert, den die Zweiradindustrie statt einer Beschränkung der Klasse 4 vorgeschlagen hatte. (FS 8/54, S. 16) Zum „Führerschein auf Probe“ nahm der Fahrlehrer Alfred Keil aus Lüdenscheid in FS 9/54, S. 5 Stellung. Er meinte damit den „Lernführerschein“ für Zweiräder. Die Ausbildung der landwirtschaftlichen Schlepperfahrer schien den Fahrlehrern 1954 zu entgleiten. (FS 9/54, S. 8) Wie Frauen rückwärts fahren, beschreibt der Fahrlehrer und Psychologe Dr. Karl Seitz in FS 9/54, S. 14. Er versucht dabei zu erklären, weshalb gerade Frauen beim Rückwärtsfahren so oft versagen. Eine der Ursachen für ihn: Frauen verwechselten nicht selten links und rechts. „Der Fahrlehrer als Verkehrserzieher“ war Chefredakteur Karl Lidl in FS 11/54, S. 6 eine halbe Seite wert. Er riet den Fahrlehrern, den Kontakt zu ihren ehemaligen Schülern zu pflegen. Im November 1954 kommt die Neuregelung der Führerscheinklassen, die die Klasse 4 auf Kraftfahrzeuge bis 50 Kubikzentimeter Hubraum beschränkt. (FS 12/54, S. 1). Das „Pneumoskop“ von Metzeler stellt FS 12/54, S. 8 vor. Es geht um einen „Meßapparat“, der von der Aufstandfläche des Reifens die Last abliest, die er tragen muss. In der zweiten Hälfte der 50er Jahre wurde die Fahrlehrer-Ausbildung erstmals diskutiert. Schon seit jeher ist es das Bestreben der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, standfeste Grundlagen für eine professionelle Fahrausbildung zu schaffen. So arbeitete die Standesvertretung bereits Mitte der 50er Jahre an Vorgaben für eine Fahrschulerlaubnis und kümmerte sich bereits stark um die Ausbildung des eigenen Nachwuchses. Jahrgang 1955 Zum Jahreswechsel schreibt Verleger Heinrich Vogel in FS 1/55, S. 1, er verstehe seine Rolle zwischen Verkehrsbehörden und Fahrlehrerorganisationen als „vermittelnde und beratende“. Er appellierte an die Fahrlehrer, die zusätzlich erwachsenen Aufgaben nicht als willkommene Geschäftserweiterung zu betrachten, sondern mit ihrem ganzen Können und ihrer Erfahrung der Verkehrssicherheit zu dienen. „Solange es Zeitungen und Zeitschriften gibt, wird es zufriedene und unzufriedene Leser geben. Je größer die Zahl der ersteren und je kleiner die der letzteren ist, desto besser ist der Schriftleiter“, schreibt Karl Lidl. Er ruft zu konstruktiver Kritik auf. „Es muss (...) unser Bestreben sein, durch eine qualifizierte Nachwuchs-Auslese, in der immer mehr auf die pädagogischen Fähigkeiten besonderer Wert gelegt wird, zu einer immer größeren Beachtung und Anerkennung unseres Berufsstandes zu kommen“, schreibt Wilhelm Bramhoff, der Vorsitzende der Bundesvereinigung, in FS 1/55, S.2. Wo soll der Prüfer bei einer Zweiradprüfung sitzen? Damit beschäftigt sich Dipl.-Ing. ??? Locher in FS 1/55, S.7. Eine Übersicht über die für Klasse 1 als Schulfahrzeug geeigneten Zweiräder bringt FS 1/55, S. 9. Kurt Boehmer berichtet in FS 1/55, S. 12 über achtwöchige Vorbereitungskurse für Fahrlehreranwärter. Sie waren an der Technischen Akademie Bergisch-Land e. V. in Wuppertal geplant. Es gab eine Eingangsprüfung. Das 225 Unterrichtsstunden umfassende Seminar solle besonders dazu dienen, „den angehenden Fahrlehrer in der freien Rede und in der pädagogisch richtigen Unterrichtserteilung zu schulen“, heißt es in dem Artikel, der bereits erwähnt, dass sich viele Anwärter völlig falsche Vorstellungen vom Beruf machten. Eine sanfte Innenbeleuchtung als Gegenmittel gegen die Blendung durch Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge empfahl eine Firma namens Antiblenda in FS 1/55, S.13. Die Serie „vorbildliche Unterrichtsräume“ wird auch 1955 fortgeführt. Der neue Kraftradführerschein ist ein Schwerpunkt von FS 2/55. Darin heißt es auf S. 23, Fahrlehrer bekämen jetzt auf ihre Schulungsmaschinen zehn Prozent Rabatt. Im Jahrgang 1955 ging es mit Inseraten von Zweiradherstellern richtig los. Stark vertreten waren auch die Rollerfabrikanten, beispielsweise das längst verblichene Fahrzeugwerk Kannenberg (FS 2/55, S. 30). Auch die Express-Werke in Neumarkt/Opf. behaupteten, ihre Express-Radex-Motorräder seien für den Fahrunterricht wie geschaffen (S. 33). Hans Glas warb für den Roller Goggo und sein Goggomobil (S. 35). FS 2/55, berichtete auf S. 33 über die Eröffnung des ersten Vorbereitungslehrgangs für künftige Fahrlehrer in Wuppertal. Die Ausbildungsstätte hat das Land Nordrhein-Westfalen am 10.1.55 den Verbänden der Kraftfahrlehrer Nordrhein und Westfalen in Selbstverwaltung übergeben. Eine gemeinsame außerordentliche Mitgliederversammlung veranstalteten die Verbände Nordrhein und Westfalen am 9.1.55. Es ging um die Neuregelungen beim Zweiradführerschein. So hatten die Teilnehmer Gelegenheit, ein mit doppelter Bremse und doppelter Kupplung versehenes Motorrad des Kollegen Böhlje aus Datteln zu besichtigen (FS 2/55, S. 39). In FS 3/55, S. 57 schlägt der Riedlinger Fahrlehrer Willi Schlegel vor, zur Ausbildung in Klasse 1 UKW-Sprechfunk einzusetzen. Es erlaubte wohl nur, dass der Fahrlehrer dem Fahrschüler Anweisungen übermittelte, nicht umgekehrt. Offenbar schulten damals noch viele Fahrlehrer mit dem Beiwagen. Längst vergessen: Das Progress-Werk Oberkirch AG, das einen „formschönen Roller“ anpries (FS 3/55, S. 59). Über eine interessante Verkehrsministerkonferenz am 3.3.55 berichtete FS 4/55, S. 61. Es ging darum, in den Führerscheinprüfungen der Klassen 1 und 3 das verkehrsgerechte Verhalten mehr in den Vordergrund zu rücken, die Einführung eines zeitlich befristeten Probeführerscheins zu prüfen und die Einzelvorschriften im Straßenverkehrsrecht zu vermindern. Offenbar hatte die Bundesvereinigung damals einzusehen begonnen, dass ihre Forderung nach einer „Bedürfnisprüfung“ nicht erhört werden würde. Schon damals wurde darüber sinniert, dass Altfahrlehrer wohl wenig bereit dazu sein werden, Anwärter in der Fahrschule auszubilden. Eine ein- bis zweijährige Berufstätigkeit als Voraussetzung zum Erwerb einer Fahrschulerlaubnis (die es noch nicht gab) wurde diskutiert. Hinsichtlich der Vorbildung der Fahrlehrer wurde diskutiert, zwischen den Klassen 1 und 3 (weniger technisch) und 2 (sehr technisch) zu unterscheiden. Das Pferdchen Kyrill „macht Karriere“, heißt es in einer Anzeige in FS 4/55, S. 71. Das Hilfsmittel sollte eine wirtschaftliche Fahrweise anzeigen. Vom selben Hersteller kam der Zigarettenhalter „Ziga“, dem man Zigaretten entnehmen konnte, ohne draufzublicken (FS 5/55, S. 86). Erfahrungen aus dem ersten Vorbereitungslehrgang für Bewerber um die Ausbildungserlaubnis beschrieb FS 5/55, S. 82. Bei der „Jahreshauptversammlung“ der Bundesvereinigung wurde Wilhelm Bramhoff (Westfalen) als Vorsitzender ebenso wiedergewählt wie sein 1. Stellvertreter Johannes Tevs. Themen waren die Forderung, ein Mindestalter von 25 Jahren für die Erteilung der Fahrlehrerlaubnis vorzuschreiben, eine Fahrschulerlaubnis einzuführen, die nicht auf einzelne Klassen beschränkt sein sollte und mindestens zwei Jahre im Angestelltenverhältnis voraussetzen sollte, sowie die Vorbildung in handwerklichem, kaufmännischem oder pädagogischem Bereich, die vorgeschrieben werden sollten. Außerdem heißt es, die Bundesvereinigung habe die Bekämpfung der „unlauteren Schleuderkonkurrenz“ fortgesetzt. Allein die Festsetzung von Mindestpreisen könne diesem Mißstand ein Ende machen, behauptete der Verband. Unter dem Motto „Fahrlehrer haben Ideen“ stellte FS 6/55, S. 101 Roller und Zweiräder vor, bei denen der Fahrlehrer vom Sozius aus mitlenken konnte. Den 2. Vorbereitungslehrgang für Kraftfahrlehrer-Anwärter in Wuppertal kündigte FS 6/55, S. 105 an. Einen Lehrgang für Fahrlehrer-Anwärter kündigt der TÜV Hannover für den 15.10.55 an (FS 9/55, S. 163). Eine „fahrschulpädagogische Arbeitsgemeinschaft“ regte der Autor Dr. Karl Seitz in FS 10/55, S. 168 an. Es sollte ein Gedankenaustausch unter Fahrlehrern sein. Funksprechverkehr im dänischen Fahrschulunterricht schilderte FS 11/55, S. 183. Der Fahrschüler musste die Funkausrüstung in einem Rucksack tragen. Eine „Reaktionsuhr als pädagogisches Hilfsmittel“ stellte FS 11/55, S. 191 vor. Man musste per Hand- oder Fußtaste Lichtsignale der Uhr quittierten. Mit Werbe-Dias für Fahrschulen beschäftigte sich ein Artikel in FS 12/55, S. 206. Sein Resümee: Dia-Einblendungen versprechen mehr Erfolg als Anzeigen, aber nur, wenn sie gut gemacht sind und nicht nur Text zeigen, sondern auch gute Fotos. Jahrgang 1956 Der Verleger Heinrich Vogel kritisiert Außenseiter, denen das Geschäft höher stünde als ihre „erzieherische Aufgabe zur Heranbildung vorbildlicher Kraftfahrer“. Er bricht eine Lanze für die „unermüdliche, zähe Arbeit der Verbände (FS 1/56, S. 1). Vorbildliche Unterrichtsräume gibt es auch im Jahrgang 1956 noch. „Der Tonfilm als Lehrmittel“ taucht in FS 1/56, S. 13 auf. In FS 3/56, S. 41 rief der Deutsche Versehrtenfahrzeug-Dienst im VdK Fahrschulen, die mit Zusatzgeräten Behinderte ausbildeten, dazu auf, sich zu melden. Neue StVO-Änderungen vom 24.2.56 bringt FS 3/56, S. 44. Eingeführt wurde zum Beispiel das Sonntagsfahrverbot von 0.00 bis 22.00 Uhr für Lkw ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht sowie Lkw mit Anhänger. Verboten wurde der Damensitz auf Motorrollern, auf denen man quer zur Fahrtrichtung saß. Auf die innere Sicherheit wies erstmals FS 3/56, S. 46 hin. Für sein „Pawin-Gerät“, eine Doppelbedienung, warb Erwin Schröttle erstmals in FS 3/56, S. 50. Die Doppelpedalerie kostete je nach Typ zwischen 65 und 85 Mark, den Summer für Prüfungsfahrten gab es für 13 Mark. Schröttles ehemaliger Arbeitgeber Max Haas warb weiterhin für seine Doppelpedalerien. Die Neuregelungen der StVO und der StVZO vom 15.3.56 schildert FS 4/56, S. 53. Neu in der StVZO sind, dass Kraftwagen einen Innen- und Außenspiegel haben müssen, und dass Krafträder, auf denen ein Beifahrer befördert wird, Sitz, Handgriff und Fußraste für denselben haben müssen. Eingeführt wurde eine Reihe neuer Verkehrszeichen, deren Farbe mit unterschiedlichen Graurastern wiedergegeben wurde. Welches Konkurrenzverbot darf ein Fahrschulinhaber seinem Angestellten auferlegen? Das beschrieb Rechtsreferendar Franz Rehm in FS 5/56, S. 74. Über die Jahresversammlung der Bundesvereinigung in Kiel berichtete FS 6/56, S. 88. Im Mittelpunkt: die Ausbildungsverordnung, die von Einsprüchen einzelner Länder verzögert wurde, der Wunsch des Bundesverkehrsministeriums, Fahrlehrer sollten 150 Volksschullehrer kostenlos in Klasse 3 ausbilden, damit sie Verkehrslehrer an den Schulen werden konnten (mit 100 gestifteten Ford-Pkw!), und das Vorhaben, die Verbandszeitschrift ab 1.7.56 nur noch Verbandsmitgliedern zur Verfügung zu stellen, sowie die Altersversorgung der Fahrlehrer. Einen Hinweis auf einen Kongress der internationalen Fahrschulorganisationen brachte FS 6/56, S. 88. Über die Situation privater Fahrlehrer „in der Sowjetzone“ berichtete FS 6/56, S. 94. Einen Vorbereitungslehrgang für Anwärter hatte es auch in Bayern gegeben; ein weiterer wurde für 1956 angekündigt (FS 6/56, S. 98). „Hamburgs neue Prüfmethode“, den Multiple-Choice-Fragebogen für die theoretische Prüfung, stellte FS 7/56, S. 102 vor. Das neue Verfahren ersetzte offenbar die mündliche Prüfung. Einen „Übungsstand für Klasse-1-Anwärter“ stellte FS /56, S. 111 vor. Die Konstruktion des Ettlinger Fahrlehrers Glaser erlaubte Fahrschülern, im Stand die Bedienung des Kraftrades zu üben. Das Antriebsrad lief dabei auf Rollen. Glaser wollte dem Mangel an geeigneten Übungsplätzen begegnen. Das Muster eines Anstellungsvertrages für Fahrlehrer brachte FS 8/56, S. 122. Bei der Mitgliederversammlung des Landesverbandes Württemberg-Baden-Hohenzollern kritisierte Verleger Heinrich Vogel die mangelhafte „Publik-Relation-Arbeit seitens der Fahrlehrer“, die an unsachlicher Berichterstattung in den Medien mit Schuld trage (FS 8/56, S. 134). Eine Liste von Fahrschulen, die „Versehrten-Ausbildung“ betreiben, veröffentlicht FS 9/56, S. 145. Als Hersteller von Zusatzgeräten werden genannt die Firmen Busch (Hamburg), Petri + Lehr (Offenbach) sowie die Münchener Hersteller Laberger und Specht. Ein „Blickmeter-Rückspiegel“ sollte die Entfernung eines herannahendes Fahrzeuges anzeigen (FS 9/56, S. 155). Der Hersteller: Anton Eisenschink in München. Einen ersten deutschen Lastwagenfahrer-Wettbewerb veranstalteten ADAC und der Verlag Heinrich Vogel am 15./16.9.56 in München (FS 10/56, S. 156). Ein „Reaktionszeit-Prüfgerät“ hatte der Tettnanger Dr.-Ing. Paul E. Klein konstruiert. Sein Gerät bildete den Sitz eines Fahrschülers mitsamt den Bedieneinrichtungen nach. Die Fahrschule Jäger in Tettnang setzte ein solches Gerät ein. Der „Internationale Verband der Kraftfahrlehrer“ wurde vom 5. bis 8.9.56 in Wuppertal gegründet. Ihm gehörten Organisationen aus zwölf Ländern an. Der Sitz der Organisation wurde nach Amsterdam gelegt (FS 10/56, S. 163). „Das Vorbeifahren am haltenden Omnibus“ beschäftigte schon 1956 den Berliner Rechtsanwalt Dr. Werner Weigelt (FS 11/56, S. 169). Den „Blendfrei-Auto-Scheinwerfer“ stellte FS 11/56, S. 175 vor. Es ging um die Trennung von Fern- und Abblendlicht. Der beinahe verabschiedungsreife Entwurf einer Fahrlehrerverordnung wurde offenbar kurz vor Torschluss ausgebremst, weil sich einflussreiche Industrie- und Wirtschaftskreise für die Erteilung einer Fahrschulerlaubnis auch an juristische Personen und nicht rechtsfähige Vereine eingesetzt hatten – vorgesehen war, diese nur natürlichen Personen zu erteilen (FS 12/56, S. 198). Jahrgang 1957 Seit 1.1.57 ist das Saarland wieder Bundesland. Der dortige Verband möchte in die Bundesvereinigung aufgenommen werden (FS 1/57, S. 2). „Ein lehrreiches Trinkgelage“ schilderte FS 2/57, S. 22. Es ging um einen Trinkversuch im Polizeipräsidium in Frankfurt am Main. Ein Merkblatt für die Ausbildung der Klasse 2 beschrieb FS 3/57, S. 42. Acella im Fahrschulwagen stellte Schriftleiter Karl Lidl in FS 3/57, S. 47 vor. Es ging um PVC im Automobilbau. Darunter stand eine halbseitige Anzeige, die für ein Medikament warb. Es sollte gegen „Kopfschmerz, mangelnde Denk- und Merkfähigkeit, Nervosität, Reizbarkeit, Potenzschwäche, Abgespanntsein, Gefühlskälte und so weiter“ wirken und hieß Levitor. „Fahrlehrer im Opel-Werk“ beginnt den Reigen der Berichte über Pflichtbesuche von Fahrlehrern bei Autoherstellern (FS 4/57, S. 55). Veigel stellt einen „Abfahrtkontroller“ vor. Er sollte anzeigen, wie der Fahrschüler das Kupplungspedal bedient. Dazu war die Anzeige, die an der Windschutzscheibe oder am Handschuhfach befestigt wurde, mit einem Bowdenzug mit dem Kupplungspedal verbunden (FS 5/57, S. 81). „Der Fahrlehrer sollte (...) ohne Rücksicht auf persönliche Interessen oder auf die finanzielle Seite soviel Ausbildungsstunden durchführen, bis er die Überzeugung gewonnen hat, dass sein Schüler mit Sicherheit die Prüfung besteht und nach bestandener Prüfung ein rücksichtsvoller und alle Verkehrssituationen meisternder Kraftfahrer ist.“ Das schreibt ein Sachbearbeiter in FS 6/57, S. 98. Über die Einteilung der Führerscheinklassen in Ostdeutschland berichtet FS 6/57 unter dem Titel „Ostzonale Fahrschulregelung“. Endlich ist sie da, die neue „Verordnung über Fahrlehrer im Kraftfahrzeugverkehr“ vom 23.7.57. FS 8/57 beschreibt sie ausführlich ab S. 129, FS 9/57 ab S. 149 und FS 10/57, S. 170. „Sind Fahrschulen gewerbesteuerpflichtig?“ fragt Günther Rothe in FS 8/57, S. 136. Der 2. deutsche Lkw-Fahrerwettbewerb fand im September 1957 erneut in München statt (FS 10/57, S. 174). Eine „Fahrschul-Funksprechanlage“ stellt FS 10/57, S. 180 vor. Unter dem Titel „Der zufriedene Fahrschüler als Werber“ stellt Karl Lidl eine „kleine Führerschein-Illustrierte“ vor – ein Produkt des Vogel Verlags, das Fahrlehrer für ihre Fahrschüler kaufen sollten (FS 10/57, S. 186). Bei der Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Kraftfahrlehrer Württemberg-Baden-Hohenzollern am 19.10.57 trat der Landesvorsitzende Hermann Horlacher zurück und gab den ihm verliehenen Ehrenvorsitz zurück. Die Leitung des Verbandes übernahm der 2. Vorsitzende ??? Henninger (FS 12/57, S. 246). Jahrgang 1958 Die Bundesvereinigung schreibt in ihrem Grußwort zum neuen Jahr, 1958 solle dem Wunsch des Bundesverkehrsministeriums entsprochen werden, 200 bis 300 Lehrer zu Selbstkosten zu Verkehrslehrern auszubilden (FS 1/58, S.2). Der TÜV Stuttgart beantwortete die bis dahin offene Frage, ob es erlaubt ist, auf einem Fahrzeug ohne Kupplung die Prüfung zu machen, mit einer Art Automatik-Eintrag im Führerschein (FS 1/58, S. 19). Bis 28.2.58 müssen Fahrlehrer ihren Betrieb bei der Erlaubnisbehörde anzeigen, dann gilt ihnen die Fahrschulerlaubnis als erteilt. FS 2/58, S. 26 gibt dazu ein Formblatt mit. Über erste Erfahrungen mit dem Fahrschulfunk berichtet FS 2/58, S. 30. Am 15.2.58 wurden laut FS 3/58, S. 45 die Prüfungsrichtlinien und die Ausbildungsrichtlinien veröffentlicht. In der Regel sollte jeder Bewerber um eine Fahrerlaubnis der Klassen 1, 2, 3 und 4 zehn Minuten mündlich geprüft werden; die Fahrprüfung sollte wenigstens 30 Minuten dauern. Näheres ab S. 48 im selben Heft. Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung wurde der niedersächsische Verband wieder in den Dachverband aufgenommen (FS 3/58, S. 66). Ein Top-??? betraf auch die Altersversorgung über die Albingia. Gegen Verkehrsübungsplätze wetterte Schriftleiter Karl Lidl in FS 4/58, S. 81. Wenn Fahrschüler mit verwandten Führerscheinbesitzern fahren dürften, bekomme der Fahrlehrer kein „unverdorbenes Material“ in die Hand. „Die privaten Fahrschulen fehlen – 27.000 Führerscheine in der Sowjetzone“ meldet FS 4/58, S. 83. Der Fahrlehrer müsse nicht auf dem Soziussitz eines Zweirades mitfahren, befindet die Bundesvereinigung in FS 5/58, S. 103. Seit 27.3.58 bekommen Inhaber einer Bundeswehr-Fahrerlaubnis innerhalb von fünf Jahren nach ihrem Ausscheiden noch zivile Fahrerlaubnisse im Umfang der Klasse 2, da die Bundeswehr sehr streng ausbilde (FS 5/58, S. 106). Die Mitglieder des Verbandes der Kraftfahrlehrer Nordrhein wählten ihren Vorsitzenden Volkmuth und dessen Stellvertreter Römer und Friedel Merz wieder (FS 5/58, S. 107). Die Bayern legten auf derselben Seite gerade ihren Fahrlehrer-Urlaub vom 4. bis 30.8. fest. Auch der 1. und 2. Vorsitzende des Verbands der Kraftfahrlehrer der Regierungsbezirke Koblenz, Montabaur, Rheinhessen, Trier wurden im Amt bestätigt. Bei der Mitgliederversammlung der Westfalen wurde ein Appell des Verlegers Heinrich Vogel verlesen, die Fahrlehrer möchten doch mehr als bisher Beiträge aus der Praxis einreichen (FS 5/58, S. 109). FS 6/58 stellt auf S. 115 die Telma-Bremse für Schwerfahrzeuge vor. Die Prüfung der Unterrichtsräume und Lehrmittel werde demnächst beginnen, warnt FS 6/58, S. 118. Über die Fahrzeug-Finanzierung berichtet erstmals FS 7/58, S. 136. Den Autor stellt die Fahrlehrerversicherung. Bei der Generalversammlung des Landesverbandes der Kraftfahrlehrer Württemberg-Baden-Hohenzollern wird der bisherige kommissarische Vorsitzende Heinz Appenzeller zum 1. Vorsitzenden gewählt. Er löst den zurückgetretenen Vorsitzenden Hermann Horlacher ab, der sich rechtfertigen musste und schließlich das Wort entzogen bekam. (Horlacher meldete sich dazu in FS 8/58, S. 170 zu Wort). Am 12.7.58 hielt die Bundesvereinigung ihre Generalversammlung ab. Der alte Vorstand (1.: Wilhelm Bramhoff, 2. Johannes Tevs, 3. Fritz Volkmuth) wurde im Amt bestätigt. Im Artikel in FS 8/58, S. 155 ist von „allerorts auftauchenden Ausbildungsinstituten für Fahrlehrer“ die Rede. Derartige Unternehmen brächten mehr und mehr ihre „materielle Einstellung“ zur Geltung, heißt es. In seiner Anzeige in FS 9/58, S. 182 verweist der Doppelpedalerie-Hersteller Veigel darauf, dass Doppelpedalerien in Fahrschulwagen oder -rollern ab 1.9.58 Pflicht seien. In den beiden Heften davor hatte dies weder in Anzeigen noch im redaktionellen Teil gestanden. Deutschlands jüngste Fahrlehrerin – eine 24-jährige namens Juliane Pott aus Bad Oeynhausen – war FS 10/58, S. 194 einen Bildkasten wert. Daraufhin meldeten sich zwei Fahrlehrerinnen, die noch jünger waren (FS 11/58, S. 232). Mit einer Trinkampullenkur möchte der Inserent Apiserum auch die Gesundheit der Fahrlehrer verbessern (FS 10/58, S. 201). Laut FS 10/58, S. 216 ist bis dahin kein Lehrgang für Fahrlehreranwärter vorgeschrieben. Es gibt auch keine Bestimmungen darüber, wer in einem Fahrlehrer-Lehrgang unterrichten darf. Auch die Länge der Ausbildung darf beliebig sein. Der IVV, der Internationale Verband für Verkehrsschulung und Verkehrserziehung“, tagte in Paris (FS 11/58, S. 223). „Zweifelsfragen im Vollzug der neuen Fahrlehrer-VO“ klärte ein Referat des bayerischen Ministerialrats Dr. Willi Stoll in FS 11/58, S. 224. Darin geht es unter anderem um die Definition einer Betriebsstelle, die die Bayern offenbar enger als andere Bundesländer fassten. Der Bayer spricht sich für eine einheitliche Fahrschulüberwachung aus. Zur Sprache kommen ferner Behördenfahrlehrer und die Vorschrift, dass für die Ausbildung in den Klassen 2 und 3 Fahrzeuge nötig sind, bei denen der Fahrlehrer in Kupplung und Bremse eingreifen kann. „Ein Fahrlehrer wird von einem Motorrad aus, das er selbst lenkt, in der Regel bis zu drei Fahrschüler schulen und beaufsichtigen können“, schreibt der Ministerialrat. Über beschränkte Höchstgeschwindigkeiten sinniert FS 12/58, S. 251. Auf einer leeren Autobahn sind Fahrzeuge abgebildet, die links fahren. Ein altes Problem also. Jahrgang 1959 „Droht eine Neufahrlehrer-Inflation?“ fragt FS 1/59, S. 10. Darin steht, die Anzahl der Fahrlehrer-„Fabriken“ nehme noch zu. Dennoch halte sich die Zahl der Neuzugänge im Rahmen der Vorjahre, heißt es im Artikel. Am 1.11.58 kamen Richtlinien für die Prüfung der Bewerber um eine Fahrlehrerlaubnis heraus. Auffallend ist, dass technische Inhalte und rechtliche Vorschriften den allerbreitesten Raum einnehmen, während das „Fahrschulwesen“ knapp wegkommt (FS 1/59, S. 19). „Großraum-Bestuhlungen“ sowie gebrauchte „Theater-Klappstühle“ bewarb die Westdeutsche Sitzmöbelfabrik Schröder & Henzelmann in FS 3/59, S. 69). Gruppenunfallversicherungen für Fahrschüler kamen in FS 4/59, S. 83 erstmals ins Blatt. Die Fahrlehrerversicherung nahm damals noch nicht an, dass es in Fahrschulen ein allgemeines Interesse an dieser Versicherungsform gebe. In FS 5/59 beklagten die Verbände Nordrhein und Westfalen, dass die Zahl der wirklich befähigten Anwärter bei den Wuppertaler Vorbereitungskursen ständig abnehme (S. 101). FS 5/59 berichtet über Erfahrungen mit der schriftlichen Theorieprüfung in Bayern und Hamburg (S. 110). Ein großes, zur Prüfung wegklappbares Dachschild bewarb VVR Verkehrsverlag Remagen in FS 6/59, U2. Die Bundesvereinigung hielt ihre Hauptversammlung des Jahres 1959 in München ab. Vorsitzender Wilhelm Bramhoff verwies darauf, dass mit der Festlegung einer Mindestausbildungsdauer in Kürze zu rechnen sei, mit der Festsetzung von Mindestgebühren hingegen noch nicht so schnell. Diskutiert wurden auch die in drei Bundesländern eingeführten „Quiz-Systeme“ – damit war die Multiple-Choice-Theorieprüfung gemeint (FS 6/59, S. 129). Auf das Thema geht nochmals FS 9/59, S. 233 ein. Den Führerschein auf Zeit, den Führerschein auf Probe und den Lernführerschein diskutierte das Verkehrsparlament der Süddeutschen Zeitung (FS 8/59, S. 189) – und ganz allgemein die Ausbildungsmethoden. Eine Leserdiskussion darüber entspann sich in FS 9/59, S. 222. Nach dem Motto „Ferien + Fahrschule = Führerschein“ hatte der AvD 1958 Ferienreisen angeboten, bei denen man den Führerschein machen konnte. Darüber berichtete FS 8/59, S. 198. Ein Thema der Jahreshauptversammlung des Landesverbandes der Fahrlehrer Pfalz waren Jungfahrlehrer. Der Verbandsvorsitzende Storck wies darauf hin, dass sich die Bezahlung der Jungfahrlehrer „in erträglichen Grenzen“ halten solle. Der Jungfahrlehrer dürfe nicht nur fahren, sondern müsse auch Vorträge halten (FS 9/59, S. 244). Auf das 25jährige Jubiläum des 1934 gegründeten Lehrmittelverlags Werner Degener weist FS 10/1959, S. 297 hin. Auf Seite 290 bewerben der Verlag Heinrich Vogel und die Werner Degener Lehrmittel GmbH gemeinsam Weihnachts- und Neujahrskarten. Zusammen mit dem Verkehrs-Verlag Remagen bewarben die beiden Verlage 1959 auch eine „Fahrlehrer-Kundenzeitschrift“, die „Die kleine Führerschein-Illustrierte“ hieß. „Neue Wege bei der theoretischen Prüfung für die Fahrerlaubnis“ zeigte in FS 12/59, S. 309, Dr. Willi Stoll. Wie Versehrte Auto fahren können, war ab S. 311 zu lesen.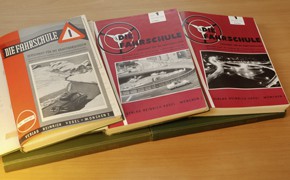
Die Jahrgänge 1960 bis 1969
60 Jahre „Fahrschule“ Das ist in den ersten 60 Jahren passiert Teil 2: Die 60er-Jahre Zusammengestellt von Dietmar Fund Fahrlehrerkammern, eine Gebührenordnung und der Umgang mit Fahrlehreranwärtern waren wichtige Themen in der ersten Hälfte der 60er Jahre. Schon fast so lange wie über Fahrschulpreise und die Prüfer reden die Fahrlehrer untereinander über das, was der Verband für sie tut. Das hat auch die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände (heutige Abkürzung: BVF) früh erkannt. Sie nutzt seit den 50er-Jahren ihre Verbandszeitschrift „Fahrschule“ dazu, die Leistungen der Verbände darzulegen. Jahrgang 1960 Ab sofort, so meldet FS 1/60, S. 1, könne jeder Fahrlehrer die „Fahrschule“ erhalten. So solle auch das Nichtmitglied vom Wert der Arbeit überzeugt werden, schreibt die Bundesvereinigung. Sie verschweigt, dass bis 1956 ebenfalls jeder Fahrlehrer die Zeitschrift erhalten konnte. „Gute Lüftung ist wichtig“, meint FS 1/60, S. 9. Beschrieben wird ein „Ventoboy“ genannter Ventilator, der in Unterrichtsräumen für genügend Sauerstoff sorgen soll. VDO präsentierte einen Geschwindigkeitswarner und ein „Sparkometer“, ein Unterdruckmessgerät, das bei Benzinern anzeigen sollte, ob der Kraftfahrer wirtschaftlich unterwegs war (FS 1/60, S. 10). Gegen Bestrebungen, erst 20-Jährige ans Pkw-Lenkrad zu lassen, wandte sich Rechtsanwalt Eberhard Capelle in FS 1/60, S. 28. Erste Erfahrungsberichte über Fahrtschreiber im Fahrschulwagen brachte FS 2/60, S. 38. Ein Fahrlehrer lobte, dass er so seine Angestellten besser kontrollieren könne. Ein anderer berichtete, die Anschaffungskosten hätten sich in kürzester Zeit amortisiert, weil er sich den von seinen Fahrlehrern auf privaten Sonntagsfahrten verbrauchten Kraftstoff rückvergüten ließ. „Die Oase der Ruhe“ pries eine Anzeige der Versandgärtnerei Arie J. van Engelen aus Kranenburg in den Niederlanden. Sie wollte Fahrlehrern offenbar ein eigenes Blumengärtchen zur Stressbewältigung anbieten (FS 4/60, S. 109). Für leichte Rasenpflege ver¬kaufte die Firma Hako den „Rasetta de Luxe“ (FS 6/60, S. 185). „Was tut die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände?“ fragt FS 5/60, S. 128. „Fahrschule“ begann mit diesem Artikel eine ausführlichere Berichterstattung über das Wirken des Dachverbands. Es ging um den Lernführerschein, den Führerschein auf Probe und die Gebührenordnung. Der Verband der Kraftfahrlehrer der Regierungsbezirke Koblenz, Montabaur, Rheinhessen, Trier wählte statt Jean Gutendorf, der sich nicht zur Wiederwahl stellte, den vormaligen 2. Vorsitzenden ??? Steinacker zum 1. Vorsitzenden (FS 6/60, S. 153). „Beeinflusst das Wetter den Fahrschüler?“ fragte ein Fachmann des Deutschen Wetterdienstes in FS 6/60, S. 160. Die Fahrlehrerverbände Bremen und Niedersachsen veranstalteten zum zweiten Mal einen Sportlehrgang für Fahrlehrer auf dem Nürburgring (FS 6/60, S. 163). „Noch ein Trockenübungsgerät“ stellte der offenbar schon gelangweilte Karl Lidl in FS 7/60, S. 199 vor. Es handelte sich um ein Gerät des Wiesbadener Fahrlehrers Hermann Kranz. Am 10.7.60 starb der bisherige Vorsitzende der Bundesvereinigung, Wilhelm Bramhoff (FS 8/60, S. 217). Der Landesverband der Kraftfahrlehrer Baden-Württemberg wählte am 26.6.60 den gesamten Vorstand wieder (FS 8/60, S. 218). Zum 1.8.60 treten Änderungen der StVO in Kraft (FS 8/60, S. 224). Die Generalversammlung der Bundesvereinigung wählte den Kölner Fritz Volkmuth zum Vorsitzenden. Erster Stellvertreter blieb der Kieler Johann Tevs, neuer zweiter Stellvertreter wurde Kurt Lange aus Frankfurt (FS 8/60, S. 228). Der Stuttgarter Fahrlehrer Helmut Dieterle baute in seinen Käfer eine Miniaturampel ein, die er selbst per Schalter betätigte. Er übte so mit seinen Fahrschülern, was bei entsprechendem Stand der Ampelsignale zu tun ist, ohne dass er Ampelkreuzungen blockieren musste (FS 8/60, S. 239). Zur geplanten Verschärfung der Fahrerprüfung informiert Fritz Volkmuth in FS 11/60, S. 319. Psychologische und pädagogische Gesichtspunkte bei der praktischen Ausbildung von Fahrschülern beschäftigen Dr. Arno Müller in FS 11/60, S. 326. Seine Devise: Mut machen. Richtlinien für Bewerber um die FzF vom 20.9.60 veröffentlichte FS 12/60, S. 345. Laut FS 12/60, S. 354, lieh Veigel Doppelpedalerien aus, die Fahrlehrer in den Fahrzeugen ihrer Schüler einsetzen konnten. Jahrgang 1961 Wie FS 1/61, S. 9, berichtet, hat ein TÜV-Sachverständiger 1959 vorgeschlagen, die praktische Prüfung ohne den Fahrlehrer durchzuführen. Das zwinge den Fahrlehrer zu einer besonders sorgfältigen Ausbildung, lautete das Hauptargument. Am 6./7.10.61 führte der VdTÜV ein Gespräch mit Kleinwagenherstellern. Es ging um die Prüfungstauglichkeit. Die späteren Kriterien Beinraum, Kopffreiheit und Heizung sowie Sichtverhältnisse kamen bereits vor (FS 2/62, S. 47). „Neue Probleme für den Fahrschulunterricht“ erwartete FS 3/61, S. 72 von der abknickenden Vorfahrtrichtung. Mit schriftlichen Führerscheinprüfungen setzt sich FS 3/61, S. 79 auseinander. Angeregt wird zum Beispiel, nach Grund- und Zusatzfragebogen zu unterscheiden. Sturzhelme für Fahrschüler der Klasse 1 bietet Hans Römer in FS 3/61, S. 86 an. Bei der Generalversammlung des Verbandes der Kraftfahrlehrer Westfalen wurde Werner Hilff zum 1. Vorsitzenden gewählt (FS 3/61, S. 101). Die Bundesvereinigung wandte sich in einer Anhörung des Bundesverkehrsministeriums gegen den Gedanken, dem Prüfer die Verantwortung für das Führen des Fahrzeugs bei der Prüfungsfahrt zu übertragen (FS 4/61, S. 106). Das neue Personenbeförderungsgesetz stellt FS 6/61, S. 192 vor. Einen „KAHE-Winkelspiegel“ präsentierte FS 6/61, S. 203. Es handelte sich um eine zweigeteilte Spiegelfläche, die den toten Winkel deutlich verringern sollte. Die Fahrschule und Wohnwagenvertrieb Werner Knopp aus Mannheim-Rheinau bewarb in FS 6/61, S. 207 einen Wohnwagen, für den er Fahrlehrerrabatt gewähren wollte. Ob ein angestellter Fahrlehrer eine Betriebsstelle leiten dürfe, fragte die Bundesvereinigung beim Bundesverkehrsministerium nach. Antwort: Wenn der Fahrschulinhaber die Betriebsstelle leitet, ist die Sache okay. Zu selbstständig durfte der Angestellte nicht sein (FS 7/61, S. 220). Die Erste-Hilfe-Ausbildung in der Fahrschule testete ein Fahrschulinhaber im Landkreis München. Sie war damals für Klasse 3 erst in der Diskussion und nur bei Busfahrern vorgeschrieben (FS 7/61, S. 224). Die Bundesvereinigung befasste sich 1961 unter anderem mit dem „Anhalterunwesen“. Außerdem wandte sich der Dachverband gegen die Meinung einiger Bundesländer, ein Fahrlehrer, der mehrere Fahrschüler zur Omnibusausbildung mitnehme, brauche eine FzF (FS 8/61, S. 260). Bei ihrer Mitgliederversammlung wählte die Bundesvereinigung am 30.6.61 Fritz Volkmuth wieder zum 1. Vorsitzenden. Wiedergewählt wurde auch der Kieler Johann Tevs als 1. Stellvertreter. Der Baden-Württemberger Heinz Appenzeller wurde 2. Stellvertreter (FS 9/61, S. 296). Ein Trockenwaschmittel namens „Weekend“ stellte FS 9/61, S. 323 vor. Karl Lidl schreibt in FS 11/61, S. 385 über den Nachwuchs. Er bemängelt, dass es nach wie vor keine Vorschriften zur Ausbildung von Fahrlehreranwärtern gebe. Lidl redet von ein paar Dutzend Fahrlehrer-Ausbildungsstätten. Die Verbände bilden seiner Meinung nach verantwortungsbewusster aus als die Institute. Karl Lidl testet in FS 11/61, S. 399 den VW 1500 als Fahrschulwagen. Er schreibt: „Dass der Motor nicht sehr elastisch ist und daher zu häufigem Schalten zwingt, ist für den Fahrschüler nur nützlich; er wird bestimmt nicht schaltfaul und kennt am Ende der Ausbildung auch keine Schalthebelscheu.“ Aussagen zum Prüfungsfahrzeug schilderte FS 12/61, S. 420. Unter anderem stand darin bereits, die Kennzeichnung eines Prüfungsfahrzeugs als Schulfahrzeug müsse abgedeckt oder entfernt sein. Jahrgang 1962 Über das Punktsystem für den Führerschein-Entzug informiert FS 1/62, S. 19. Am 17.3.62 wurde anstelle des verstorbenen Fritz Volkmuth (Nordrhein) Johannes Tevs aus Kiel zum Vorsitzenden der Bundesvereinigung gewählt. Leo Steinacker aus Koblenz wurde stellvertretender Vorsitzender (FS 2/62, S. 62). Dritter im Bunde war Heinz Appenzeller, Stuttgart. Die Bundesvereinigung beschloss, ein eigenes Büro mit einem Geschäftsführer zu schaffen. Für ihren „Schreibprojektor“ warb die Firma Liesegang. Es war offensichtlich ein Overhead-Projektor (FS 3/62, S. 76). Eine „Schüler-Kontrollkarte im Schulwagen“ stellte die Füssener Firma Bäurle her (FS 3/62, S. 87). Am 10.2.62 wählte der Verband der Kraftfahrlehrer Nordrhein den bisherigen 2. stellvertretenden Vorsitzenden Friedel Merz zum 1. Vorsitzenden (FS 3/62, S. 98). Der Fahrlehrer-Verband Hamburg wählte Richard Grage zum 1. Vorsitzenden, Erich Koschollek zum 2. und Rolf Walther zum 3. Vorsitzenden (FS 4/62, S. 143). Gesetzliche Anforderungen an die Ausbildung von Fahrlehreranwärtern und Ausbildungsstätten verlangte FS 9/62, S. 335. Der Artikel machte unterschwellig Werbung für das seit 1.1.62 in Quelle angesiedelte Verkehrsinstitut, das damals offenbar nur von den Landesverbänden Nordrhein und Westfalen getragen wurde. „Fortschritt durch Rationalisierung“ versprach die „Schnelle Fahrschule“ aus Hamburg-Altona, die den US-Drivotrainer bewarb (FS 10/62, S. 341). Ob in der Fahrschule auch Fahrzeuge mit Automatik oder automatischer Kupplung zulässig seien, diskutiert FS 12/62, S. 414. Im Artikel wird auch die Frage aufgeworfen, ob nur ein Wagen einer Fahrschule Doppelpedale haben müsse oder jeder einzelne. „Das Autobad“ von PROHI wurde in FS 12/62, S. 417 beworben. Jahrgang 1963 Wie schon 1962, warb Klippan auch 1963 stark für seine Sicherheitsgurte. Keine Erfindung der 90er-Jahre sind offensichtlich Luftverbesserer für das Auto. In FS 1/63, S.63 wurde ein Lufverbesserer namens Autodor vorgestellt. Er wurde oberhalb der Defrosterdüsen an der Windschutzscheibe befestigt. Mit Pril wusch man 1963 offensichtlich auch Fahrschulautos. „Wer Pril nimmt, spart gutes Geld“ hieß es in FS 2/63, S. 59. Eine Fahrschule für Fortgeschrittene stellte FS 2/63, S. 61 vor. Ein rheinischer Fahrlehrer bildete ältere Semester auf einem E-Type von Jaguar in sportlich-fairer Fahrweise aus. Ein Blendschutzgerät stellte FS 3/63, S. 78 vor. Einen Winkelspiegel von KAHE präsentierte FS 5/63, S. 187. Der linke Außenspiegel war horizontal geteilt, wobei das obere Drittel nach links drehbar war, um den toten Winkel auszuschalten. Offenbar wollte der VdTÜV 1963 die Ausbildung in der Fahrschule nur bis zur theoretischen Prüfung führen, dann einen Lernführerschein ausstellen und den Fahrschüler im Straßenverkehr selbst lernen lassen, um nach einer praktischen Fahrprüfung den endgültigen Führerschein zu bekommen. Dagegen wandte sich die Bundesvereinigung (FS 7/63, S. 253). „Fahrlehrer oder Laie als Ausbilder?“ fragte auch Amtsgerichtsrat Werner Verweyen in FS 8/63, S. 287. Herrenkosmetik der Reihe „Men´s Line“ wollte das „Welthaus“ Coty den Fahrlehrern in FS 8/63, S. 299 nahebringen. Neue Richtlinien für die Führerscheinprüfung stellt FS 9/63, S. 329, vor. Es ging um eine Verschärfung der seit 1958 gültigen Richtlinien. Erstmals wurde der gesamte theoretische und praktische Prüfstoff bundeseinheitlich geregelt und abgegrenzt. Technische Fragen wurden zurückgestutzt. Die Prüfungsordnung für Fahrlehrer solle eine praktische und mündliche Lehrprobe vorschreiben, schrieb FS 9/63, S. 332 in einem Bericht über eine Ausschusssitzung. Dort wurde auch ein Merkblatt für Fahrlehreranwärter erarbeitet. Erste Erfahrungen mit dem Sehtest bei Fahrprüflingen beschrieb FS 9/63, S. 341. Den „großen Mercedes“ 600 bewarb Mercedes-Benz in FS 10/63, S. 387. Ob die Fahrlehrerschaft Berufskammern anstreben solle, diskutierte die Bundesvereinigung in FS 11/63, S. 429. Offenbar waren sich die Funktionäre nicht schlüssig, denn sie riefen die Mitglieder dazu auf, Anregungen und Wünsche zu dieser Frage einzubringen. Der Verband Nordrhein fand Gefallen an Berufskammern (FS 12/63, S. 471). Argumente gegen die Laienausbildung sammelte die Bundesvereinigung in FS 12/63, S. 476. Schon damals ging es um die Kosten der Fahrausbildung in Fahrschulen. Die Bundesvereinigung forderte auch einen obligatorischen Sehtest. Jahrgang 1964 Ohne Fahrlehrer kann man Fahrschüler nicht gut und hinreichend ausbilden: Von dieser Meinung konnte die Bundesvereinigung im Bundesverkehrsministerium offenbar einige Interessengruppen überzeugen. Bei einem Gespräch in Bonn legte die Bundesvereinigung dar, dass die „Autotrainer“ noch zu wenig leistungsfähig seien (FS 1/64, S. 7). Dass auch 1964 schon in erster Linie mit dem Preis geworben wurde, zeigt FS 1/64, S. 9. Nachdem der 400 Fragen umfassende Bundesfragenkatalog eingeführt worden war, wendet sich die Bundesvereinigung gegen „Fragebücher“ der Lehrmittelverlage, die sich wohl teilweise auf leicht abweichende Fragen und Antworten der einzelnen TÜV gestützt haben. Begründung: Fahrlehrer können stolz darauf sein, Verkehrserzieher zu sein, die ihren Schülern nicht nur den Wortlaut der amtlichen Prüfungsbögen einhämmern (FS 1/64, S. 35). Als Gedankenstütze für den Fahrlehrer entwickelte ein Münchener Fahrlehrer einen „Fehlerlocher“ für 148 Mark. Der Fahrlehrer musste für die typischen Fehler eine von 24 Tasten drücken. Auf einer Lochkarte konnte er nach Abschluss der Fahrt feststellen, welche Fehler der Fahrschüler häufig gemacht hatte, um die Fahrt nachzubesprechen. Der Erfinder argumentierte, sein System lenke den Fahrlehrer weniger ab als das Aufschreiben auf einen Notizblock (FS 2/64, S. 49). Die Bundesvereinigung werde sich für eine Fahrlehrerkammer einsetzen, berichtete der Verband in FS 3/64, S. 69. Außerdem wurde eine Verbesserung der Fahrlehrerverordnung angestrebt. Das Verkehrsinstitut in Quelle berichtete, eine gute Ausbildung sei eine wesentliche Voraussetzung für das Bestehen der Fahrlehrerprüfung. Gastredner war Dr. Gerhard Munsch, der etwas über den Verkehrssinn erzählte. In FS 4/64, S. 113 beklagte die Bundesvereinigung, dass die Bundesländer die Frage des Automatik-Eintrags beim Pkw-Führerschein ganz unterschiedlich behandelten. Am 29./30.5.64 wurde der geschäftsführende Vorstand wiedergewählt. Vorsitzender blieb also Werner Hilff, 1. stellvertretender Vorsitzender Leo Steinacker und 2. Stellvertreter Heinz Appenzeller (FS 7/64, S. 250). Ministerialrat Hüttebräucker hatte auf der Versammlung über die Möglichkeit referiert, dass auch Laien im Rahmen einer „beschränkten Einzelerlaubnis“ Fahrschüler ausbilden dürften. Sie wäre darauf hinausgelaufen, dass die theoretische Ausbildung beim Fahrlehrer gelegen hätte, die praktische Ausbildung hingegen nicht. Weiterhin wurden diskutiert: die Möglichkeit, künftig auch auf Autobahnen auszubilden (bis dahin verboten) und ein einheitliches Schild für Fahrschulwagen. Gegen das Schulen an Sonn- und Feiertagen wandte sich die Bundesvereinigung in FS 8/64, S. 297 unter anderem mit dem Argument, dass an solchen Tagen viele Sonntagsfahrer mit geringer Fahrpraxis unterwegs seien. Eine Entwicklung von Fichtel & Sachs erlaubte es, im Ford 17 M die automatische Kupplung durch ein Kupplungspedal zu ergänzen. Bei laufendem Motor konnte man umschalten. So ließ sich der Wagen für die Schulung als Schaltwagen oder mit der Automatik nutzen (FS 8/64, S. 302). Zehn Jahre Verkehrs-Institut feierte die Bundesvereinigung in FS 9/64, S. 345. Vom niedersächsischen Verband war noch nicht die Rede. Das Verkehrs-Institut war damals die einzige inserierende Fahrlehrer-Ausbildungsstätte. „Unser Beruf ist hoffnungslos überbesetzt“, referierte der baden-württembergische Vorsitzende Heinz Appenzeller in FS 9/64, S. 348. Er stellte schon damals fest, dass die Durchführung der Prüfung „in hervorragendem Maße richtungweisend“ für die Gestaltung der Ausbildung sei. Außerdem kritisierte er die Fahrschulüberwachung und trat für eine Fahrschulkammer ein. Als „zündende Idee“ verkaufte die Deutsche Zündwaren-Monopolgesellschaft ihre Zündholzbriefchen mit Werbeaufdruck (FS 10/64, S. 405). Mit einer Wettbewerbsordnung für die Fahrlehrer glaubte die Bundesvereinigung ihren Wunsch nach einer Fahrlehrerkammer durchsetzen zu können (FS 11/64, S. 437). Ab 1965 sollten Fortbildungslehrgänge für Fahrlehrer im Verkehrs-Institut Quelle bundesweit durchgeführt werden, berichtete die Bundesvereinigung in FS 12/64, S. 481. Danach wurden „Wettbewerbsregeln für die Fahrlehrerschaft“ geschildert. Die Bundesvereinigung wollte sie beim Bundeskartellamt genehmigen lassen. Eine „Anti-Schleuder-Bahn“ in Hamburg stellte FS 12/64, S. 487 vor. Ihr Erbauer stellte Fahrlehrern für erste Fahrversuche auf der Bahn einen Wagen zur Verfügung. Einige Grundlagen der heutigen Arbeit und technische Sonderlösungen prägten die zweite Hälfte der 60er-Jahre. Jahrgang 1965 Wie aus dem Rückblick auf 1964 in FS 1/65, S. 8 hervorgeht, wurden 1964 der Sehtest und fremdsprachige Fragebögen eingeführt. Die Bundesvereinigung wolle eine Intensivierung der Betriebsberatung der Fahrschulinhaber prüfen, hieß es in dem Bericht auch. Für eine „Feuerhand-Combilampe“ wurde in FS 1/65, S. 20 geworben. Es handelte sich um eine Warnblinkleuchte. Für eine einheitliche Überwachungspraxis setzte sich die Bundesvereinigung beim Bundesverkehrsministerium ein. Sie forderte Kommissionen, denen je ein Vertreter von Fahrerlaubnisbehörde, TÜV und Fahrlehrerschaft angehören solle (FS 3/65, S. 89). „Stiefkind Fahrschule in der Zone“ ist ein Artikel in FS 3/65, S. 108 betitelt. Kritisiert wurde, dass sich in der DDR niemand systematisch um das Fahrschulwesen kümmere. Warnfackeln zur Absicherung liegen gebliebener Fahrzeuge empfahl FS 3/65, S. 112. „Das Bestreben der Bundesvereinigung und der Landesverbände muss es sein, den Fahrlehrer als Verkehrserzieher immer mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen“, ist in FS 4/65, S. 139 zu lesen. Wichtig fand der Dachverband deswegen, Richtlinien für die Ausbildung der Fahrschüler und eine Ausbildungsverordnung für Fahrlehrer zu schaffen und damit den Berufsstand zu heben. Bei der Jahreshauptversammlung der Hessischen Kraftfahrlehrer am 3.4.65 wurde Willi Heisch zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt (FS 5/65, S. 182). In FS 5/65, S. 207 wurde für Kölnisch Wasser geworben. Es stammte allerdings aus Heilbronn von der Joh. Chr. Fochtenberger KG. Bei der Mitgliederversammlung des Fahrlehrer-Verbandes Hamburg wird Rolf Walther zum 1. Vorsitzenden gewählt (FS 6/65, S. 230). Wie FS 6/65, S. 235 berichtet, hat Werner Hilff als Vorsitzender der Bundesvereinigung nach zehn Jahren wieder eine Besprechung mit dem Bundesverkehrsminister (es war Dr.-Ing. Hans Christoph Seebohm) gehabt. Bei der Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Kraftfahrlehrer Baden-Württemberg wurde der „Kollege Heiler“ erstmals aktenkundig: Er setzte sich als Beiratsmitglied für eine Erhöhung des Jahresbeitrages für das Geschäftsjahr 1965 ein (FS 8/65, S. 328). Bei der Generalversammlung der Fahrlehrer Niedersachsens wurde Ernst Fröhling zum 3. Vorsitzenden gewählt. 1. Vorsitzender wurde Karl Meyer, 2. Bernhard Ratering (FS 8/65, S. 330). „Neue Grundsätze für die Eröffnung von Fahrschulen“ setzte das Bundesverwaltungsgericht am 1.6.65 (FS 9/65, S. 362). Es ging um die Fahrschulerlaubnis. In FS 10/65, S. 413 taucht Heinzmartin Nitsche zum ersten Mal im Impressum auf. Damals noch ohne Doktor, aber bereits als Stellvertreter Karl Lidls, des Schriftleiters. Nitsche durfte den IAA-Bericht abliefern. Das nordhrein-westfälische Wirtschaftsministerium hat im April 1965 die von den Verbänden Nordrhein und Westfalen eingereichten Wettbewerbsregeln genehmigt. Die Bundesvereinigung sieht das als wichtigen Zwischenschritt auf dem Weg zur Einrichtung von Fahrschulkammern (FS 10/65, S. 417). Einen Auto-Fahrstand pries der Baden-Badener Inserent Formeta in FS 10/65, S. 441. Er konnte über einer Grube oder auf ebener Fläche montiert werden. Auf den Rollen, die die Antriebsräder aufnahmen, sollten Fahrschüler kuppeln, schalten und bremsen lernen. (1/1-Anzeige in FS 12/65, S. 549) Jahrgang 1966 In FS 3/66, S. 85 verteidigt die Bundesvereinigung die von ihr initiierten, allgemeinverbindlichen Wettbewerbsbedingungen für Fahrlehrer als den bestmöglichen Kompromiss. Der Dachverband kündigt ein Kalkulationsschema an, das man in Recklinghausen anfordern konnte. Noch immer hoffte der Verband auf die Einrichtung einer Kammer, die ein Berufsverbot hätte aussprechen können. Zur Vorstandssitzung der Bundesvereinigung in Braunschweig hatte das Volkswagenwerk einen Tagungsraum zur Verfügung gestellt. Zuvor waren Sponsoren kein Thema gewesen (FS 4/66, S. 135). Fiat macht in einer Anzeige in FS 6/66, S. 241 als erster Fahrzeughersteller darauf aufmerksam, dass man einen Fahrschulwagen auch mieten kann, statt ihn zu kaufen. Die Rede ist dann allerdings von Leasing. Nach dem Rücktritt des 1. Vorsitzenden Heinz Appenzeller wird am 4.6.66 Heinz Grüne¬wald zum 1. Vorsitzenden des Landesverbandes der Kraftfahrlehrer Baden-Württemberg gewählt. Als stellvertretender 1. Vorsitzender taucht Gebhard Heiler auf (FS 7/66, S. 279). In ihrer Mitgliederversammlung zeigte sich die Bundesvereinigung davon überzeugt, dass Bundesverkehrsministerien und Länderreferenten mit dem Verband darin einig seien, dass man eine Fahrschulerlaubnis brauche. Ein Thema wurden nun auch die Bundeswehrfahrlehrer (FS 7/66, S. 283). Wegen des Rücktritts von Heinz Appenzeller wurden der Bayer Franz Spreitzer zum 1. und der Hamburger Rolf Walther zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. „Fahrlehrergesetz in Vorbereitung“, meldete FS 8/66, S. 333. Es solle Aufgaben der Fahrlehrer und Fahrschulen im modernen Straßenverkehr umreißen. Der Fahrlehrer müsse auch eine pädagogische Befähigung aufweisen, heißt es. Eine interessante Studienreise für Kraftfahrlehrer ist für die Lufthansa Anlass zu einem Inserat in FS 8/66, S. 359. Dahinter stand offenbar der baden-württembergische Landesverband, der in FS 9/66, S. 395 eine Fachstudienreise nach USA ankündigt. „Sicherheitsarbeit koordinieren!“, meint Heinzmartin Nitsche in FS 10/66, S. 474. „Das Ergebnis der angespannten Aktivitäten ist in den meisten Fällen sehr gering“, schreibt er zum Nebeneinander vieler Organisationen, die in der Verkehrssicherheitsarbeit mitmischen. In FS 10/66, S. 479 inseriert erstmals ein weiteres Ausbildungsinstitut neben dem Verkehrs-Institut Quelle. Es ist das Verkehrs-Päda¬gogische Institut VPI, eine Organisation des baden-württembergischen Verbandes. Autohansa bewirbt auf der selben Seite seine Fahrschul-Mietwagen. Baden-Württemberg führte ab dem 25.10.66 versuchsweise eine Kennzeichnung für Neulinge im Straßenverkehr ein. Es war ein N in Verbindung mit einem vierblättrigen Kleeblatt (FS 11/66, S. 490). Verteilt wurde das Kennzeichen über die Fahrschulen. Die Bundesvereinigung vereinbarte mit dem Verband Auto-Sicherheitsgurte, dass Fahrlehrer die Gurte zu günstigen Bedingungen beziehen konnten (FS 11/66, S. 497). Die ersten Broschüren unter dem Titel „Fahren lernen mit VW“ stellt FS 11/66, S. 522 vor. Daran hatte die Bundesvereinigung mitgewirkt. Auch Auto-Sixt bot in München und Frankfurt/Main Leihwagen für Fahrschulen an (FS 11/66, S. 541). „Amerika war schon eine Reise wert“, schreibt in FS 12/66, S. 579 Gebhard Heiler, der danach noch eine Menge ähnlicher Reisen organisieren sollte – und gleich in FS 1/67, S. 24 nochmals unter demselben Titel schrieb. Die nächste kündigte er 1966 gleich unter dem Artikel im Inserat an. Den gesamten Lehrstoff für die theoretische Führerscheinprüfung versprach Pirola-Schallplatten auf einer Lehrschallplatte zu bringen. „Der Fahrschüler lernt, als ob ihm ein Fahrlehrer das erforderliche Wissen ständig ins Ohr flüsterte, er lernt durch bloßes Abhören beim Frühstück, nach Feierabend, vor dem Schlafengehen“, verspricht die Kleinanzeige in FS 12/66, S. 591. Jahrgang 1967 Unter dem Motto „Treffpunkt Fahrschule“ versuchte der baden-württembergische Verband, auch Führerscheinbesitzer mit jahreszeitlich bedingten Aktionen anzusprechen (FS 1/67, S. 4). In FS 1/67, S. 14 kündigte die Bundesvereinigung an, „dass in nächster Zeit ein entscheidender Schritt zur Formung eines Berufsbildes“ getan werden müsse. Stellung und Arbeit des Fahrlehrers müssten „auf gesetzlicher Basis“ klar umrissen werden. Noch immer laborierten die Verbände am Wegfall der Fahrschulerlaubnis durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1.6.65. Inwiefern Unterrichts- und Verkehrssicherheitslehre Bestandteil der Ausbildung von Fahrlehrern werden sollten, diskutierten Ende Januar 1967 Vertreter der Verbände, der TÜV und der Ministerien im Verkehrs-Institut Quelle (FS 3/67, S. 87). Dabei wurde auch untersucht, inwiefern die „Unterrichtslehre“ prüfbar ist. Damals wurde großer Wert auf das Lehr- und Unterrichtsgespräch gelegt. „Caravaning im Vormarsch“ heißt ein Artikel, mit dem FS 3/67, S. 100 die Idee vertritt, Fahrlehrer sollten Gespannfahrer zu ein paar Fahrstunden animieren. Am 24./25.3.67 diskutierte die Bundesvereinigung den Entwurf des Fahrlehrergesetzes. Offenbar arbeitete der Dachverband schon damals eng mit dem Bundesverkehrsministerium zusammen. Die Bundesvereinigung schlug vor, einige Neuregelungen auf dem Verordnungswege zu treffen, um sie rascher aktualisieren zu können (FS 4/67, S. 131). Fahrschulwagen mit Lenkrad- und Mittelschaltung bewarb Simca in FS 4/67, S. 141 – die Typen 1301 und 1501. Die Doppelausstattung gab es auf Wunsch. Der nicht benutzte Hebel machte alle Schaltungen mit. Eine ähnliche Konstruktion offerierten auch der Opel-Händler Ott in Kirchheim/Teck (FS 7/67, S. 282) und die Fahrschule und Kfz-technischer Metallbau in Gerlingen (FS 8/67, S. 319). Bei der Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung erklärte deren Vorsitzender Werner Hilff, auch Altfahrlehrer müssten sich hinsichtlich der Unterrichts- und Verkehrssicherheitslehre weiterbilden (FS 5/67,S. 175). FS 6/67, S. 231 wetterte gegen den Dekra-Vorschlag, einen Führerschein auf Probe einzuführen. Der Dekra war offenbar der Meinung, Fahranfänger sollten ihr Fahrzeug kennzeichnen, unter 100 km/h bleiben, sich auf Fahrzeuge mittelstarker Motorisierung beschränken und 15.000 Kilometer Fahrleistung erreichen müssen, bevor der Führerschein auf Probe zum regulären werden sollte. Das Verkehrs-Institut Quelle sah die Bundesvereinigung in FS 8/67, S. 299 als „ihr“ Ausbildungsinstitut, als ein „Instrument, der Fahrlehrerschaft sehr schnell die zur Fortsetzung ihrer Berufsausübung notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln“. Für gebrauchte Wagen warb BMW in FS 9/67, S. 341 – wohl schon damals waren die Bayern etwas teurer. Über Alternativ-Schaltungen berichtete Karl Lidl in FS 9/67, S. 360. In späteren Heften erweiterten die Anbieter ihren Radius auf immer mehr Modelle (FS 10/67, S. 426). Eine Art Stempelautomat für Fahrschüler verkaufte die Württembergische Uhrenfabrik Bürk Söhne, Schwenningen. In FS 10/67, S. 421 warb sie für ihr Gerät, das zum Erfassen des Unterrichtsbesuches diente. Zum kommenden Fahrlehrergesetz interviewt Verleger Heinrich Vogel in FS 12/67, S. 494 den Staatssekretär Karl Wittrock. Darin kommt unter anderem zur Sprache, dass das Bundesverkehrsministerium plante, Fahrlehrer-Fachschulen einzuführen, deren Besuch obligatorisch werden sollte. Abgehend vom Führerschein auf Zeit schlug Vogel eine Art „Führerschein auf Bewährung“ vor. Jahrgang 1968 Unter dem Titel „In Krefeld brodelt es“ finden sich in FS 1/68, S. 4 einige selbstkritische Worte zu Verbandsberichten: „Kleingedruckt stehen unserer Verbandszeitschrift seit vielen Jahren die Versammlungsberichte voran. Die braven Versuche, das mehr oder weniger reputierliche Vereinsgeschehen festzuhalten, lösen mitunter in der Aufzählung der Ehrengäste und dem Aneinanderreihen konventioneller Floskeln gepflegte Langeweile aus“, schreibt ein leider nicht genannter Autor. „Die Überbesetzung unseres Berufes und der sich verstärkende Konkurrenzkampf wurde inzwischen berufsgefährdend“, stellt die Bundesvereinigung in ihrem Neujahrsgruß in FS 1/68, S. 7 fest. Auf ihre Gruppenversicherungsverträge mit den Verbänden weist die Vereinigte Krankenversicherung A. G. in FS 1/68, S. 13 hin. Einen Sicherheits-Leuchtstab bewarb die Firma E. & F. Hörster aus Solingen in FS 1/68, S. 29. Mit einem „Autofahrers Digest“, der sich an ehemalige Fahrschüler richtete, warb der Manfred Roser Verlag aus Stuttgart in FS 2/68, S.59. Der monatlich erscheinende Titel war offenbar unter Schirmherrschaft der Bundesvereinigung entstanden. Nach dem System des Bad Tölzer Fahrlehrers Ernst Thissen traten in FS 2/68, S. 65 erstmals die „Tölzer Doppelpedale“ werblich in Erscheinung. Es handelte sich um Doppelpedalerien für VW-Modelle, die man ohne Verschraubung auf den Mitteltunnel aufsetzte. In FS 3/68, S. 78 sprach sich die Deutsche Verkehrswacht für die Einführung eines Führerscheins auf Probe aus. In FS 3/68, S. 81 fordert die Bundesvereinigung im Zusammenhang mit dem Fahrlehrergesetz die obligatorische Ausbildung des Fahrlehreranwärters in amtlich anerkannten Fahrlehrerausbildungsstätten und die gesetzliche Einführung von Mindest- und Höchstentgelten im Fahrschulwesen. Außerdem forderte die Bundesvereinigung, dass der angehende Fahrlehrer Kenntnisse in der Betriebswirtschaft nachweisen können müsse. Noch immer werben Gärtnereien um Fahrlehrer, beispielsweise die Elmshorner Firma Horstmann und das Rittergut Birkhof, in FS 3/68. Vom 26.2. bis 3.3.68 tagte die Bundesvereinigung im Verkehrs-Institut Quelle. Unter anderem ging es um den Führerschein auf Zeit, den der Dachverband ablehnte. Stattdessen plädierte die Bundesvereinigung für eine erneute Prüfung auffällig gewordener Verkehrsteilnehmer (FS 4/68, S. 124). Mit Lenkrad- und Knüppelschaltung stellte auch Peugeot seinen 204 als Fahrschulwagen vor (FS 5/68, S. 179). „Fahrschulwagen mit oder ohne Automatik?“ Diese selbst gestellte Frage beantwortete Petri & Lehr mit der „Haro-Drive“ genannten automatischen Kupplung. Sie wurde nachträglich eingebaut und machte die Kupplungsbetätigung per Knopfdruck entbehrlich (FS 5/68, S. 189). Am 4.5.68 wurde Fritz Rauscher in Bayern zum Nachfolger des verstorbenen Landesvorsitzenden Franz Spreitzer gewählt. Mit FS 8/68 ist Heinzmartin Nitsche erstmals „verantwortlich für den Inhalt“. Karl Lidl, ein Heft zuvor noch Schriftleiter, ist für die redaktionelle Beratung zuständig geworden. Nach 17 Jahren verabschiedet sich Schriftleiter Lidl (FS 8/68, S. 230). Die neuen Räume des Verkehrspädagogischen Instituts Baden-Württemberg e. V. in Schorndorf präsentiert FS 7/68, S. 259). Der Artikel lobt die Aufbauarbeit des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg. Helmut S. Rentschler leitete das Institut. Auf ihrer Mitgliederversammmlung am 24./25.5.68 diskutierte die Bundesvereinigung unter anderem über die Ausbildung auf Fahrzeugen mit automatischer Kraftübertragung. Der Dachverband wollte die Beantwortung der Frage, ob es zu einem Automatikeintrag kommen solle, den TÜV überlassen (FS 7/68, S. 267). Ernst Fröhling wurde bei dieser Sitzung zum Rechnungsprüfer gewählt. „Die Fahrlehrer-Verbände und ihre Fachzeitschrift“ hieß eine Nabelschau in FS 7/68, S. 274. Als Schöpfung der Baden-Badener Firma Formeta wird in FS 8/68, S. 324 erstmals ein per Magnet und Vakuumwirkung haftendes Dachschild beschrieben. Am 9.8.68 stirbt der ehemalige Schriftleiter Karl Lidl (FS 9/68, S. 340). Das 10-jährige Jubiläum des Verkehrs-Institutes Quelle feierte FS 10/68, S. 408. Als Träger fungierte damals auch die Bundesvereinigung. Damit notleidende Fahrlehrer ihr Entspannungs-Gärtchen umsonst bewässern konnten, bot die Firma Klein, Schanzlin & Becker aus Frankenthal ihre Vielzweckpumpe Rovex in FS 10/68, S. 439 an. Von einem im Werden befindlichen Deutschen Verkehrssicherheitsrat berichtet FS 11/68, S. 446. Laut dem zitierten Bundesverkehrsministerium sollte dadurch die Verkehrssicherheitsarbeit gebündelt und damit wirkungsvoller werden. Jahrgang 1969 Werner Hilff, Vorsitzender der Bundesvereinigung, wurde im September 1968 zum IVV-Präsidenten gewählt, meldet FS 1/69, S. 14. In FS 1/69, S. 32 bewirbt erstmals auch Petri & Lehr eine synchronisierte Doppelschaltung für einige Pkw-Typen. Ein riesiges Fahrschule-Dachschild präsentierte VVR Verkehrsverlag Remagen in FS 4/69, S. 104. „Das Fahrlehrergesetz ist im Bundesrat“, meldete FS 4/69, S. 118. Am 1.5.69 wurde Ernst Fröhling vom 2. zum 1. Vorsitzenden des Verbandes der Kraftfahrlehrer Niedersachsen „befördert“ (FS 5/69, S. 154). Laut FS 5/69, S. 160 wurde zum 1.8.69 die Teilnahme an einem Kurs zu Sofortmaßnahmen am Unfallort zu einer Voraussetzung für den Führerscheinerwerb. Laut einer Anzeige der Firma Dambach in FS 6/69, S. 221 ist seit 1.7.69 bei TÜV-Untersuchungen und ab 1.7.70 in allen Pkw ein Warndreieck mitzuführen. Am 3.5.69 wählte die Jahresversammlung des Landesverbandes Hessen Willi Heisch zum 2. Vorsitzenden (FS 7/69, S. 242). Nicht gesagt ist, ob es der „heutige“ Willi Heisch war oder sein Vater. Bei ihrer Mitgliederversammlung am 28./29.5.69 erhob die Bundesvereinigung die Forderung, Voraussetzung zur Erlangung der Fahrschulerlaubnis solle eine mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit als angestellter Fahrlehrer sein. Eine nebenberufliche Tätigkeit genüge nicht (FS 7/69, S. 251). „Hamburger Fahrlehrer tranken für die Wissenschaft“ meldete FS 7/69, S. 259 über einen Trinkversuch. Am 11.7.69 beschloss der Bundesrat das Fahrlehrergesetz. Das meldete FS 8/69, S. 290. Die wichtigsten Grundzüge beschreibt FS 9/69, S. 321. Am 26.6.69 wurde in Bad Godesberg der Deutsche Verkehrssicherheitsrat gegründet (FS 8/69, S. 302). Sofortmaßnahmen am Unfallort kamen mit der StVZO-Änderung, die FS 9/69, S. 342 beschreibt. Eingriffe des Fahrlehrers bei der Automatik-Schulung schildert FS 10/69, S. 372. Laut DV FahrlG müssen Fahrschulautos mit einem amtlichen Fahrschule-Schild gekennzeichnet sein (FS 10/69, S. 378). Einen von innen verstellbaren Außenspiegel für den VW-Käfer preist Hagus in FS 10/69, S. 399. Gleiches tut Keiper in der Anzeige in FS 11/69, S. 427. „Sicherheitssack in der Erprobung“, meldet FS 12/69, S. 476. Gemeint war einer der ersten Airbags.
Die Jahrgänge 1970 bis 1979
60 Jahre „Fahrschule“ Das ist in den ersten 60 Jahren passiert Teil 3: Die 70er-Jahre Zusammengestellt von Dietmar Fund Neue Richtlinien für Ausbildung und Prüfung sowie die Fahrschulüberwachung wurden in der ersten Hälfte der 70er-Jahre heiß diskutiert. Mit dem Fahrlehrergesetz hatte der Berufsstand 1969 die wichtigste Grundlage seiner Arbeit durchsetzen können. Danach packte die Bundesvereinigung zügig weitere Regelwerke wie die Fahrschüler-Ausbildungsordnung oder die Prüfungsrichtlinie an. Schon damals wurde kontrovers über eine wirksame Fahrschulüberwachung diskutiert, die gegen die Auswüchse des harten Preiswettbewerbs dringend geboten schien. Jahrgang 1970 „Von innen dran drehen“: Mit diesem Slogan bewirbt Hagus aus Solingen den von innen verstellbaren Außenspiegel für den VW Käfer (FS 1/70, S. 7). „In eigener Sache“ gibt Verleger Heinrich Vogel bekannt, dass die Verlagsgruppe Bertelsmann die Mehrheit an seinem Verlag übernommen hat (FS 1/70, S. 12). Als erste Fahrlehrerausbildungsstätte bekommt das Verkehrs-Institut in Quelle die amtliche Anerkennung zugesprochen (FS 2/1970, S. 42). Wie es in dem Artikel heißt, sind einige Landesverbände und die Bundesvereinigung Mitglieder des gemeinnützigen Vereins, der hinter dem Institut steht. Die Agria-Werke in Möckmühl warben in FS 2/70, S. 51 für ihre Gartengeräte. Mit der Schaffung einer Ausstattungsricht¬linie für Fahrschulen und der Fahrschulüberwachung beschäftigte sich der Länderausschuss „Technische Kraftfahrzeugüberwachung“, in dem auch die Bundesvereinigung saß. Außerdem stellte die Bundesvereinigung in FS 3/70, S. 81 fest, dass die Länder in der Frage der Anbringung des Fahrschule-Schildes unterschiedlicher Meinung seien. Bei der Fahrschulüberwachung sah man die TÜV nicht als geeignete Organisationen an. „Wie muss eine moderne Fahrschule eingerichtet sein?“: Diese Frage beantwortet die Bundesvereinigung in FS 4/70, wo über den Stand der Ausstattungsrichtlinie detailliert berichtet wird. FS 5/70, S. 155 meldet, dass Gebhard Heiler am 21.3.70 „mit überwiegender Stimmenmehrheit“ zum 1. Vorsitzenden des Landesverbandes der Kraftfahrlehrer Baden-Württemberg gewählt worden ist. Im Mittelpunkt der „Generalversammlung“ des Landesverbandes Bayerischer Fahrlehrer standen am 12.4.70 offenbar die Besonderheiten von Fahrzeugen mit automatischer Kraftübertragung (FS 5/0, S. 155). Am 2./3.4.70 wurde Werner Hilff als 1. Vorsitzender der Bundesvereinigung bestätigt. Neuer 1. Stellvertreter wurde Ernst Fröhling, neuer 2. Stellvertreter Fritz Rauscher (FS 5/70, S. 163). FS 6/70, S. 210 druckt die neue Ausstattungsrichtlinie ab, die am 26.3.70 veröffentlicht worden war. Am 15.6.70 stirbt Heinrich Vogel (FS 7/70, S. 3). Über die sich abzeichnende Ausbildungsrichtlinie für Fahrschüler berichtete die Bundesvereinigung in FS 10/70, S. 355. Zum 1.3.71 sollte die neue StVO in Kraft treten. Darauf weisen 1971 verschiedene Anzeigen von Verlagen hin, während die Redaktion nur über Vorstufen der StVO berichtet. Dass der Pedalerie-Hersteller Wilhelm Veigel 50 Jahre alt geworden ist, meldet FS 12/70, S. 454. Jahrgang 1971 Der Hamburger Verband setzte sich für einen Automatikeintrag in den Pkw-Führerschein ein, den die meisten Bundesländer offenbar nicht für nötig hielten (FS 1/71, S. 2). Seit November 1970 dürfen Fahrschulwagen bei Ausbildungsfahrten das amtliche „Fahrschule“-Schild an Front und Heck tragen (FS 1/71, S. 10). In ihrer Sitzung vom 26.11.70 setzte sich die Bundesvereinigung dafür ein, eine zweite Prüfung für angehende Fahrlehrer vorzuschreiben, die sie nach zwei Jahren Tätigkeit als angestellter Fahrlehrer ablegen sollten. Dieses Modell setzte der Dachverband gegen die unzureichende Überwachung einer ordnungsgemäßen Ausbildung der Fahrschüler (FS 1/71, S. 13). Die Bundesvereinigung empfahl Verbandsfahrschulen, die in Baden-Württemberg geschaffene rote Raute mit dem Slogan „gut betreut – Verbands-Fahrschule“ zu verwenden. Über die neue Prüfungsrichtlinie berichtet FS 2/71, S. 47. Die bisherigen „Quizfragen“ werden jetzt durch Fragen ergänzt, bei denen der Fahrschüler selbst Zahlen et cetera eintragen muss. Über die Grundlagen der Lernpsychologie informiert Dr. Dr. ??? Böcher in FS 3/71, S. 81. Seit 11.3.71 sind reflektierende Kennzeichen zugelassen (FS 4/71, S. 147). Die „obligatorische Weiterbildung von Fahranfängern“ bringt der Fahrlehrer-Verband Hamburg in die Diskussion. Der Führerschein sollte erst nach einem Jahr Fahrpraxis sowie einem „Sicherheits- und Gefahrentraining“ unbegrenzt erteilt werden (FS 5/71, S. 164). In einer dafür erstellten Broschüre wendet sich der Verband auch gegen die Fahrausbildung in der Schule. In FS 5/71, S. 193 tritt ein gewisser Reg.-Dir. Dr. Wolfgang Bouska erstmals in Erscheinung, und zwar mit zwei Abhandlungen über drei Verkehrszeichen. Über Kooperationsgespräche mit den Nachbarverbänden Pfalz und Saar berichtete FS 6/71, S. 210 im Bericht über die Mitgliederversammmlung der Baden-Württemberger. Geplant war eine „Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Verbände“. Auf Seite 212 heißt es, dass die Rheinländer den Zusammenschluss mit den Pfälzern beabsichtigten. Auf ihrer Mitgliederversammlung am 21.5.71 diskutierte die Bundesvereinigung heftig über eine neue Satzung, unter anderem über die Stimmrechte der Landesverbände. Einig war sich der Vorstand darin, dass der Vorsitzende und seine beiden Stellvertreter die Bundesvereinigung nach außen vertreten sollten. Erneut trat das Gremium für eine „Fahrschul¬leiterprüfung“ ein (FS 6/71, S. 228). „Kühlen auch Sie Ihren Arbeitsplatz“, schrieb die Firma Behr über ihren Air Conditioner in FS 7/71, S. 247. Parallel dazu bewirbt Behr noch längere Zeit seinen Ventilator „Auto-Quirl“. In FS 8/71, S. 3 wird berichtet, Gebhard Heiler habe den Bezug der Zeitschrift „Fahrschule“ gekündigt und sich damit gegen die bisher gehandhabte Zensur gewandt. Heiler gründete anschließend die Fahrschulpraxis. Nicht erkennbar ist, von wem der Text stammt, der auf eine Grundsatzerklärung („Grünwalder Erklärung“) hinweist, die Heinrich Vogel 1965 gegenüber den Verbänden abgegeben hat. Seit 1.3.71 können Fahrschüler auch auf Auto¬bahnen geprüft werden, berichtet FS 8/71, S. 293. Erstmals wirbt in FS 8/71, S. 304 das Institut für integrierte Verkehrsbildung in der Bundesrepublik – zusammen mit dem Deutschen Verkehrs-Pädagogischen Institut. Wie FS 9/71, S. 329 berichtet, haben zum Jahresende 1971 sechs Landesverbände ihre Mitgliedschaft in der Bundesvereinigung gekündigt: Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Pfalz, Rheinland und Saar. Ursache war die Stimmrechtverteilung. Bis 1969 (und wegen Verfahrensmängeln auch danach) hatte jeder Landesverbandsvorsitzende eine Stimme, jeder Mitgliedsverband eine und zusätzlich je eine für pro 100 angefangene Mitglieder. Bei der Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung wurde unter eifriger Beteiligung von Gebhard Heiler erneut über die Kündigung und das Stimmrecht diskutiert. Heiler drängte darauf, dass der geschäftsführende Vorstand jüngeren Leuten Platz machen sollte. Knapp entschied sich der Vorstand dafür, dass künftig die Verbandsvorsitzenden den geschäftsführenden Vorstand mit je einer Stimme wählen sollten (FS 10/71, S. 377). In FS 11/71, S. 401 gibt Albert Braun seine Geschäftseröffnung an, die am 15.10.71 stattgefunden hat. Seine erste Produkt-Annonce findet sich auf Seite 438. Zum 20.9.71 hat das Bundesverkehrsministerium die Ausbildungsrichtlinien veröffentlicht (FS 11/71, S. 421). Der deutsche Verkehrssicherheitsrat setzte sich mit Hilfe der Schlagersängerin Peggy March für einen „Klimawechsel im Verkehr“ ein (FS 11/71, S. 430). Zur Kennzeichnung von Fahrschulwagen nimmt Dr. Wolfgang Bouska in FS 12/71, S. 486 auführlich Stellung. Dachschilder gab es damals offenbar noch nicht. Jahrgang 1972 Daimler-Benz dehnte den fünfprozentigen Verwerternachlass für Fahrschulen auf angestellte Fahrlehrer aus, heißt es in FS 3/72, S. 107. Den Nachlass gab es gegen Vorlage des Fahrlehrerscheins, wenn das Auto mit einer Doppelpedalerie ausgerüstet wurde. Wie es in einem Bericht über die Vorstandssitzung der Bundesvereinigung heißt, wollte die Bundesvereinigung 1972 erreichen, dass die Überwachung unterbleiben könne, wenn der Fahrschulinhaber eine Fortbildung besucht habe. Das fernere Ziel war, eine Fahrschulleiterprüfung einzuführen (FS 5/72, S. 189). Ein weiteres Thema war das Drängen des DVR, an Schulen eine „Driver Education“ einzuführen. Der damalige Leiter der Abteilung Verkehrserziehung, Siegfried Werber, verteidigte sich mit dem Hinweis, er wolle auch Fahrlehrer als Instruktoren in den Schulen unterbringen. Ferner forderte die Bundesvereinigung, den Besuch einer anerkannten Fahrlehrerausbildungsstätte vorzuschreiben. Wie FS 6/72, S. 212 meldet, kündigte der Pfälzer Landesverband bis 30.6.72 „vorsorglich“ die Mitgliedschaft in der Bundesvereinigung. BMW verschärft 1972 die Bedingungen für den zehnprozentigen Verwerternachlass. So musste das Fahrzeug auf die Fahrschule zugelassen werden, und außerdem war keine Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagens vorgesehen (FS 8/72, S. 298). Ab 1.11.72 wird der Führerschein Klasse 3 auf Automatik-Fahrzeuge beschränkt, wenn die Prüfung auf einem Automatik-Wagen abgelegt wurde – es sei denn, der Fahrschüler hat mindestens sechs Fahrstunden auf einem Wagen mit Schaltgetriebe absolviert (FS 8/72, S. 308). Mit einem Informationsblatt will der TÜV Bayern 1972 Fahrschülern die Angst vor der Prüfung nehmen (FS 9/72, S. 342). In FS 9/72, S. 375 warb die Stuttgarter PVF, Einkaufsgenossenschaft Deutscher Fahrlehrer eGmbH, für die Mitinhaberschaft in einem bundesweiten Fahrlehrer-Unternehmen. Es sollte nicht nur Fahrlehrerbedarf anbieten, sondern auch Dienstleistungen, die die wirtschaftliche Existenz der Fahrlehrer sichern sollten. Eine „Auto-Ideal-Hose“ mit einem dehnbaren Bund bewarb die Firma mobil-elasto in FS 10/72, S. 401. Eine kombinierte Lenkrad- und Knüppelschaltung bewarb noch 1972 der Opel-Händler Ott aus Kirchheim/Teck (FS 10/72, S. 425). Am 8.10.72 gründen sieben Landesverbände den Bundesverband Deutscher Fahrlehrerverbände e. V.: Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Pfalz, Rheinland, Schleswig-Holstein und Saar (FS 11/72, S. 444). Anlass zur Neugründung war eine Debatte über das Stimmrecht. Mit der „Spikes-Verordnung“ vom 8.11.72 werden Spikes-Reifen an Fahrzeugen bis 2,8 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht von 15. November bis 15. März zugelassen. Man durfte damit aber nur 100 km/h fahren und musste ein Temposchild ans Fahrzeug kleben (FS 12/72, S. 483). Jahrgang 1973 Wie FS 1/73, S. 9 zum Jahreswechsel bemerkt, sind die Landesverbände aus Baden-Württemberg und Hamburg 1972 aus der Bundesvereinigung ausgetreten. Gebhard Leo Heiler hatte eine zweite berufsständische Organisation auf Bundesebene gegründet. Sie hieß „Bundesverband Deutscher Fahrlehrerverbände e. V.“ und bestand aus den Verbänden Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Rheinland, Pfalz und Saar. Am 25.11.72 wählte dieser Verband Gebhard Heiler zum 1. Vorsitzenden, Rolf Walther aus Hamburg zum 2. und Erwin Halenke aus Berlin zum 3. Vorsitzenden (FS 1/73, S. 12). Seela taucht als Inserent auf (FS 1/73, S. 20), ebenso Schechinger (S. 31). Die Bundesvereinigung nannte in FS 2/73, S. 60 als drei Schwerpunkte ihrer Arbeit, die unzureichende Fahrschulüberwachung durch eine Pflichtfortbildung zu ersetzen, Berufsbild des Fahrlehrers zu schaffen und die Öffentlichkeitsarbeit zusammen mit DVR und DVW zu verstärken. Bei der Jahreshauptversammlung des Kraftfahrlehrer-Verbandes Berlin kam Peter Glowalla in den Vorstand, zuständig für den „Vergnügungsausschuss“ (FS 5/73, S. 192). Eine einheitlichere Gestaltung der Fahrlehrerausbildung forderte die Bundesvereinigung in FS 5/73, S. 204. Diskutiert wurde auch über eine Nachschulung junger Fahranfänger sowie über die Anforderungen an Laienausbilder. Bei der Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung am 25.5.73 wurden Werner Hilff, Ernst Fröhling und Fritz Rauscher einstimmig in ihren Ämtern bestätigt (FS 6/73, S. 248). Gegen die Forderung des DVR nach einer Fahrausbildung in der Schule wendet sich Rolf Walther in FS 8/73, S. 332. Rolf Walther wandte sich in FS 10/73, S. 420 gegen den Vorschlag des TÜV Rheinland, die Fahrprüfung ohne Fahrlehrer durchzuführen. Stattdessen hätte der TÜV-Prüfer seinen mit einer Video-Aufzeichnung versehenen Wagen nehmen sollen. Das Berufsbild des Fahrlehrers skizzierte FS 10/73, S. 444. Abgedruckt war ein Arbeits¬papier, das der hessische Landesverband im Auftrag der Bundesvereinigung erstellt hatte. Die sich abzeichnende Ausbildung zum Berufskraftfahrer wollte die Bundesvereinigung zur Sache der Fahrlehrer machen (FS 11/73, S. 462). In derselben Vorstandssitzung wurde gegen die Fahrausbildung in der Schule Stellung bezogen. Als neues Arbeitsfeld zeichnete sich auf DVR-Anregung der Instruktor für Sicherheitstrainings ab. Ab 1.1.74 galt die Verordnung über die Berufsausbildung zum Berufskraftfahrer (FS 12/73, S. 510). In FS 12/73, S. 516 wird berichtet, dass Gebhard L. Heiler damals den Gedanken aufbrachte, die Fahrlehrerversicherung in eine AG umzuwandeln. Jahrgang 1974 Bei der Vorstandssitzung am 26.1.74 erneuerte die Bundesvereinigung ihren Vorschlag, dass eine mehrtägige Fortbildung die Fahrschulüberwachung ersetzen können solle (FS 2/74, S. 50). Die Bundesvereinigung griff im übrigen einen Kompromissvorschlag von Rolf Walther auf, der zur Wiedervereinigung der beiden Bundesverbände führen sollte. Mitgliedsverbände bis zu 300 Mitgliedern sollten demnach drei Zusatzstimmen für den Verband erhalten, solche mit mehr als 300 bis 600 Mitgliedern zwei Zusatzstimmen. Hubert Müller wurde am 23.2.74 zum Stellvertretenden Vorsitzenden des Landesverbandes Bayerischer Fahrlehrer gewählt (FS 4/74, S. 112). Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Deutscher Fahrlehrerverbände beschloss am 15.3.74, in die Bundesvereinigung zurückzukehren, die ihr Stimmrecht zu ändern versprochen hatte (FS 4/74, S. 120). Der Berliner Landesverband beschloss am 23.4.74, wieder in die Bundesvereinigung einzutreten (FS 6/74, S. 178). Auf ihrer Mitgliederversammlung schlug die wieder vollzählige Bundesvereinigung vor, die praktische Ausbildung durch obligatorische Langstrecken- und Nachtfahrten zu intensivieren. „Schleuderfahrten“ und ein Sicherheitstraining im Rahmen der Ausbildung lehnte der Verband aber ab. Eine Neuordnung der Fahrlehrerausbildung solle mindestens Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife fordern; außerdem solle es eine obligatorische Ausbildungsordnung für Fahrlehreranwärter geben. Auch eine Zweigstellenbegrenzung war im Gespräch (FS 6/74, S. 188). In FS 9/74, S. 289 schlug der Inserent Ortwin Müller vor, dass sich Fahrlehrer ein zweites Einkommen durch den Verkauf von echten Lammfell-Autositzen sichern sollten. Im Bericht über die Mitgliederversammlung der Berliner Fahrlehrer ist in FS 9/74, S. 301 zu lesen, dass die Berliner Fahrschul-Rundschau bereits zweimal erschienen sei und dass die Redakteure Peter Glowalla und Gerhard Fürst um regere Mitarbeit gebeten hätten. Der Hamburger Landesverband bekam von der Bundesvereinigung den Auftrag, die neu konzipierte Ausbildungs-Diagrammkarte und damit die Stufenausbildung praktisch zu erproben (FS 10/74, S. 304). In den 70er-Jahren diskutierten die Verbände über die Zweirad- und die Lkw-Ausbildung. Auch die ersten Sicherheitstrainings wurden besprochen. Die zweite Hälfte der 70er-Jahre brachte den Fahrlehrern die ersten Regulierungsversuche, die ihre Fahrschul-Pkw betrafen. Abwehren mussten die Fahrlehrerverbände Bestrebungen, den theoretischen Teil der Fahrausbildung weitgehend in Schulen zu verlagern. Eigene Akzente setzte die Bundesvereinigung damals mit der neuen Ausbildungs-Diagrammkarte, den ersten Wettbewerbsregeln und den ersten Lkw-Fortbildungen im Daimler-Werk Wörth. Jahrgang 1975 Am 10.1.75 wurde Ernst Fröhling zum Vorsitzenden der Bundesvereinigung gewählt. Der 1. Stellvertreter wurde Rolf Walther, der 2. Gebhard Heiler (FS 2/75, S. 38). Bei der Mitgliederversammlung des Landesverbandes Bayerischer Fahrlehrer wurde Fritz Rauscher einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt. Er bekam die Zustimmung zu seinem Vorhaben, aus der Bundesvereinigung auszutreten, wenn diese die Mitgliedsbeiträge erhöhe. Bei der Versammlung taucht erstmals Gerhard von Bressensdorf auf (als „Gerhard von Brechensdorf“!), der zu einem von drei Rechnungsprüfern gewählt wurde (FS 4/75, S. 110). Die Mitgliederversammlung des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg beschloss, im Rundfunk für Verbandsfahrschulen zu werben (FS 6/75, S. 184). „Nachschulung von Kraftfahrern“ heißt der erste Band der Schriftenreihe der Bundesvereinigung, der 1975 erschienen ist (FS 6/75, S. 200). Bei der Mitgliederversammlung des Kraftfahrlehrer-Verbandes Berlin wird Peter Glowalla zum 1. Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt (FS 7/75, S. 216). Der HUK-Verband verlieh den Christophorus-Preis für Fachzeitschriften 1975 an die „Fahrschule“ (FS 7/75, S. 229). Die Fahrschule Willy Heisch – damals noch nicht in vorderster Front des Verbandes – erhielt die 100.000. Doppelbedienung von Veigel (FS 8/75, S. 253). Über die neue BOKraft informiert FS 8/75, S. 258. Die 1. Verordnung zur Änderung der StVZO bringt FS 9/75, S. 300. Auf seinem ersten Pädagogik-Seminar wurde der Vorstand der Bundesvereinigung im Umgang mit der Ausbildungs-Diagrammkarte geschult (FS 10/75, S. 322). Am Overhead-Projektor: Prof. Dr. Hellmut Lamszus. Erstmals stellt FS 11/75, S. 368 eine Liste prüfungstauglicher Pkw zusammen. Die „Kleine Kommission“ des VdTÜV hatte von 50 im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums begutachteten Modellen 32 für geeignet befunden. Der bayerische Innenminister Dr. Bruno Merk schlug vor, beim freiwilligen Besuch eines Verkehrsseminars in Fahrschulen Punkte in Flensburg zu tilgen (FS 11/75, S. 371). Auch für VW Polo und Audi 50 gab es noch die Tölzer Doppelpedale (FS 11/75, S. 380). Der Vorstand der Bundesvereinigung stellte fest, dass es keine einheitlichen Kriterien zur Beurteilung der Prüfungstauglichkeit von Pkw gebe (FS 12/75, S. 398). Zur selben Zeit arbeitete das Bundesverkehrsministerium an solchen Kriterien (S. 399). „Fahrschule“ wurde um den Redakteur Hilmar Schmitt erweitert, wie das Impressum von FS 12/75, S. 400 verrät. Jahrgang 1976 Nach einer Änderung des Fahrlehrergesetzes muss ein Fahrlehreranwärter ab Januar 1976 eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten Lehrberuf nach abgeschlossener Hauptschulausbildung oder eine gleichwertige Vorbildung vorweisen können. Ferner kann die Verwaltungsbehörde nun von der Fahrschulüberwachung absehen, wenn der Inhaber der Fahrschulerlaubnis und alle angestellten Fahrlehrer jährlich an einem Fortbildungslehrgang in einer anerkannten Ausbildungsstätte teilgenommen haben (FS 1/76, S. 10). Weitere Neuerungen wie die Höchstarbeitszeit für Fahrlehrer schildert FS 2/76, S. 38. Die geänderte StVO beschreibt FS 1/76, S. 12. Unter anderem gibt es ein neues Verkehrszeichen, das Sonderfahrstreifen für Linienbusse kennzeichnet, sowie das heute gebräuchliche Ortsendeschild. Wie FS 2/76, S. 40 meldet, hat der Landesverband Bayerischer Fahrlehrer zum 31.12.75 die Mitgliedschaft in der Bundesvereinigung gekündigt. Im Dezember 1975 wurden den Bundestagsabgeordneten ein Vorschlag der EG-Kommission für einen EG-Führerschein vorgelegt. Er sah acht Führerscheinklassen vor: A, B, C, D, E, F, F2 und G (FS 3/76, S. 79). FS 3/76, S. 82 meldet, dass Dr. Wolfgang Bouska, damals 43, neuer Verkehrsreferent im bayerischen Innenministerium geworden ist. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Kraftfahrlehrerverbandes Berlin wird Peter Glowalla zum 1. Vorsitzenden gewählt (FS 4/76, S. 113). Bei einer Fortbildungsveranstaltung des Fahrlehrerverbandes Pfalz hielt ein gewisser Rudolf Ebel ein Referat über den Wert des Sicherheitstrainings für die Fahrpraxis (FS 5/76, S. 157). Bei der Mitgliederversammlung des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg bekam Gebhard Heiler erst nach kontroverser Diskussion die Zustimmung für eine weitere zweckgebundene Abgabe zur Finanzierung der Rundfunkwerbung (FS 6/76, S. 184). Als „wichtigstes Thema“ auf lange Sicht sah der Vorstand der Bundesvereinigung die Einführung einer zweiten Prüfung für Fahrlehrer (FS 6/76, S. 198). Als eine wichtige Aufgabe sah man auch die Zulassung von Pkw mit Kopfstützen für die Prüfung. „VW bietet Fahrschulwagen mit Doppelbedienung“ meldet FS 6/76, S. 203. Die Doppelpedalerie kostete damals 341 Mark. Über die Fahrschülerausbildungsordnung, die zum 31.5.76 erlassen worden war, informiert FS 7/76, S. 232. In FS 8/76, S. 272 und FS 10/76, S. 340 wird erstmals stark über den Sinn eines Sicherheitstrainings diskutiert, das manche Fahrlehrer als „Schleuderkurs“ ablehnten. Stark engagiert war der 1. Stellvertretende Vorsitzende der Bundesvereinigung, der Hamburger Rolf Walther. Ob für die Sonderfahrten höhere Preise verlangt werden sollten, diskutierte FS 11/76, S. 404. Jahrgang 1977 Bei der Vorstandssitzung der Bundesvereinigung am 3./4.12.76 kam die vorgesehene Typprüfung für Doppelpedalerien erstmals zur Sprache (FS 1/77, S. 6). Im Jahrgang 1977 tauchen große 2/1-Anzeigen von Motorradherstellern auf. Über Modellversuche zur Nachschulung auffällig gewordener Kraftfahrer informiert FS 3/77, S. 102. Die Verkehrsseminare wurden in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durchgeführt. Gleichzeitig legte die Bundesanstalt für Straßenwesen eine Studie über die typischen Verhaltensweisen der Fahranfänger und Möglichkeiten gezielter Nachschulung vor. Auf seiner Mitgliederversammlung wandte sich der bayerische Vorsitzende Fritz Rauscher gegen den Wunsch des TÜV, die Prüfung unter Ausschluss des Fahrlehrers im Wagen des TÜV-Prüfers durchzuführen (FS 4/77, S. 131). Bei der Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Fahrlehrer Saar wurde Günter Henne am 19.3.77 zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt (FS 5/77, S. 178). Die Ausbildung in Klasse 2 muss besser werden, lautete das Resümee von Teilnehmern an einem Klasse-2-Fortbildungsseminar der Hessen im Mercedes-Werk Wörth (FS 6/77, S. 228). Gefahren wurde noch auf 38-Tonnern. Am 1.4.77 trat das Gesetz über die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in Kraft. Die Bundesvereinigung erarbeitete einen Entwurf, den die Landesverbände auf der Mitgliederversammlung am 20./21.5.77 übernahmen (FS 6/77, S. 232). Die neuen Klasse-1-Fragen stellt FS 6/77, S. 249 vor. „Soll die Führerschein-Ausbildung in die Schule wandern?“ Die Gefahr hinter dieser Frage diskutierte der Vorstand der Bundesvereinigung am 4.7.77. Die Diskussion war durch eine Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen entfacht worden (FS 8/77, S. 310). Man befürchtete, dass zumindest die theoretische Ausbildung in die Schule abwandern sollte. Wie es in dem Artikel außerdem heißt, sollten ab 1.9.77 gemäß DVFahrlG Doppelpedale eine Typprüfung haben. Dafür wollte die Bundesvereinigung eine einjährige Übergangsfrist erwirken (vgl. dazu FS 9/77, S. 354). Die Mitglieder des Fahrlehrerverbandes Berlin stimmten Wettbewerbsregeln zu, die der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg fast unverändert übernahm (FS 11/77, S. 426). Der 1. Vorsitzende Peter Glowalla bezeichnete diesen Beschluss als den weitaus wichtigsten der zurückliegenden Jahre. Eine Umfrage zur Ausbildung in Klasse 1 machte die Bundesvereinigung in FS 11/77, S. 438 mit angehängtem zweiseitigem Fragebogen. Beim Klasse-1-Weiterbildungsseminar der Pfälzer Fahrlehrer hielt Seminarleiter Rudi Ebel einen Vortrag über fahrtechnische und fahrphysikalische Probleme des Zweiradfahrers (FS 12/77, S. 466). Außerdem führte er vor, wie ein Sicherheitstraining für Zweiradfahrer aussehen könnte. Eine permanent verstellbare „Sit-Rückenstütze“ bewarb die Münchner Sit GmbH in FS 12/77, S. 488. Bedient wurde sie mit einer Handpumpe, befestigt per Klettband. Jahrgang 1978 Erneut diskutierte der Vorstand der Bundesvereinigung Ende 1977 über das VdTÜV-Merkblatt 731, die Liste prüfungstauglicher Fahrzeuge. Sie wurde offenbar in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich stark beachtet (FS 1/78, S. 11). Gebhard Heiler kündig¬te für das Frühjahr 1978 ein Konzept für ein Motorrad-Sicherheitstraining an. In FS 2/78, S. 37 warb Europcar um Fahrlehrer, die als zweites Standbein eine Autovermietung aufmachen sollten. Bei einer Bezirksversammlung am 11.2.78 in Augsburg referierte das „Verbandsmitglied“ von Bressensdorf über Erfahrungen mit Funkanlagen in der Klasse-1-Ausbildung. Schon damals fand er, dass keines der Systeme 100prozentig sei (FS 4/78, S. 113). „Die Rolle des Fahrlehrers in der Nachschulung“ diskutierte der Vorstand der Bundesvereinigung mit Prof. Dr. Hellmut Lamszus (FS 4/78, S. 118). Bei der 78er-Mitgliederversammlung der Westfalen taucht Alfons Wahlich erstmals als Rechnungsprüfer auf (FS 6/78, S. 185). Die Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung trat am 19./20.5.78 dafür ein, die Prüfung auf Automatikwagen ohne Automatik-Eintrag wieder zu streichen (FS 6/78, S. 199). Am 16.3.78 tritt die „Richtlinie zur Begutachtung von Doppelbedienungseinrichtungen“ in Kraft. Doppelpedalerien brauchen nun eine Allgemeine oder eine Einzelbetriebserlaubnis (FS 7/78, S. 238). Im selben Heft und auch in FS 8/8 wirbt der Hersteller Haas noch für seine Doppelpedalerien. Über den Pilotlehrgang für Klasse-2-Fahrlehrer in Wörth berichtete Emil Veser in FS 8/78, S. 272. Referent war damals schon Peter Scheurenbrand von Daimler-Benz. Als -StVZO-Spezialist tauchte Peter Tschöpe auf. Wie FS 9/78, S. 292 berichtet, wurden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Fahrschulen nach der Prüfung durch das Bundeskartellamt im Bundesanzeiger veröffentlicht. Am 22./23.9.78 diskutierte der Vorstand der Bundesvereinigung die Frage, ob das Kartenlesen Bestandteil der Fahrausbildung werden solle. Diese Frage des Bundesverkehrsministers beantwortete das Gremium mit nein (FS 10/78, S. 324). Weiter ging es in der Sitzung um zwei Versuche mit reflektierenden Dachschildern in Karlsruhe und in Bayern sowie eine Richtlinie für die Zulassung von Prüfungsfahrzeugen. Der Vorstand wandte sich gegen Bestrebungen, nur noch viertürige Pkw als Prüfungsfahrzeuge zuzulassen. Die Liste der bisher geprüften Pkw bringt FS 11/78, S. 376. In FS 11/78, S. 382 stellt der Verlag Heinrich Vogel seinen „Microcator-Spiegel“ vor. Er wurde auf die Windschutzscheibe geklebt und zeigte mit Leuchtpfeilen an, in welcher Richtung ein Fahrschüler blinkte. Eine „Mai-Star-Motorradabschleppachse“ bewarb der Anhängerbau Glas aus Großweil in FS 12/78, S. 417. „Wie kommen Körperbehinderte zum Führerschein?“ frägt FS 12/78, S. 428 nach langer Pause. Das Thema war bis dahin nur in den 50er-Jahren im Zusammenhang mit Kriegsversehrten aufgegriffen worden. Das Jahr 1978 schließt, ohne dass die Bayern in die Bundesvereinigung zurückgekehrt wären. Im Impressum ist mit FS 8/78 Maria Swoboda als Redakteurin aufgetaucht. Ab FS 2/79 ist sie nicht mehr mit von der Partie. Jahrgang 1979 Das Nachschulungsmodell der Bundesvereinigung wird in Modellversuchen in Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg erprobt (FS 1/79, S. 6). Laut einer Stellungnahme des bayerischen Innenministeriums wurde die Betriebserlaubnispflicht für Neuzulassungen am 1.9.80, für bereits in Betrieb befindliche Pkw am 1.9.82 (FS 1/79, S. 10) eingeführt. Das steht auch auf S. 27 in der amtlichen Verlautbarung. Haas wirbt noch immer. „Kann der Fahrlehrer freier Mitarbeiter sein?“ fragte FS 1/79, S. 12. Die Antwort lautete schon damals nein, sofern es um eine Lehrtätigkeit geht. Den ersten Doppelinnenspiegel ab Werk bietet VW für die Modelle Golf, Polo, Derby und Passat an. Er war nachrüstbar (FS 3/79, S. 87). Über die ersten beiden Lkw-Fortbildungen des Landesverbandes Bayerischer Fahrlehrer bei MAN berichtete FS 4/79, S. 124. Schon damals als Organisator dabei: Hubert Müller. FS 5/79, S. 160 berichtet, dass die Verbände Nordrhein und Westfalen eine Pressestelle neu eingerichtet hätten. Als Referent für die damals stark diskutierte Zweiradausbildung taucht erstmals Arnold Wymar auf. Künftig nur noch zwei Zweirad-Führerscheinklassen kündigt FS 5/79, S. 168 an. Zur Problematik der Zweiradausbildung informieren Wolfgang Böcher und Hubert Koch in FS 5/79, S. 188. Am 24.3.79 wählen die Mitglieder des Landesverbandes der Fahrlehrer Saar Günter Henne zum 2. Vorsitzenden (FS 6/79, S. 204). Über die beabsichtigte Einführung eines „Leichtmotorrads“ diskutierte die Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung 1979 in Berlin. Außerdem beschloss das Gremium, eine Studienstelle zu gründen, die die Arbeiten der Bundesvereinigung wissenschaftlich begleiten und untermauern sollte (FS 6/79, S. 224). Am 17.3.79 wird Gerhard von Bressensdorf einstimmig zum Bezirksvorsitzenden in Schwaben gewählt (FS 7/79, S. 248). Wie eine gute Motorrad-Fahrschulausbildung aussehen sollte, schildert Hubert Koch in FS 7/79, S. 256. Am 18.5.79 wurde das neue Gebäude des Verkehrs-Instituts Bielefeld in der Lerchenstraße eingeweiht. Nach dem Unfalltod seines 1. Vorsitzenden Werner Uerz wählte der Fahrlehrer-Verband Rheinland Hans Sonntag zum 1. Vorsitzenden (FS 8/79, S. 284). Die berufsständische Abrechnungszentrale für Fahrschulen kündigt die Bundesvereinigung in FS 8/79, S. 286 an. Sie sollte den Fahrschulen Verwaltungs- und Inkassoprobleme abnehmen. Der baden-württembergische Ministerialrat Dr. Rolf Gall setzt sich in FS 8/79, S. 300 dafür ein, auch Fahrschulen in Form einer GbZ oder einer GmbH zuzulassen. Statt der September-Ausgabe 1979 ist FS 9/78 erneut eingeheftet!!! Wie FS 10/79, S. 357 meldet, möchte das Bundesverkehrsministerium für die Klasse-1-Ausbildung schwerere Motorräder einführen. Am 27.7.79 wird die neue Prüfungsordnung für Fahrlehrer verkündet (FS 10/79, S. 380). Bei der Mitgliederversammlung betonte der Berliner Vorsitzende Peter Glowalla, dass sich sein Landesverband beim Beschluss der Bundesvereinigung, eine Verrechnungsstelle für Fahrlehrer einzurichten, der Stimme enthalten habe. Glowalla befürchtete, eine finanzstarke dvf könnte zur Umwälzung der Verbandsstruktur führen (FS 11/79, S. 402). Bei der Vorstandssitzung der Bundesvereinigung am 2./3.11.79 wurde Volker Schill als Fahrschul-Ansprechpartner bei VW eingeführt (FS 12/79, S. 448). Das Jahr 1979 beschließt die Bundesvereinigung erneut ohne die Bayern (FS 12/79, S. 449). Die neue Führerschein-Einteilung meldet FS 12/79, S. 458. Bei unveränderten Klassen 2 und 3 galten die Klassen 5, 4, 1, 1b und Fahrräder mit Hilfsmotor bis 25 km/h ab 1.4.80.
Die Jahrgänge 1980 bis 1989
60 Jahre „Fahrschule“ Das ist in den ersten 60 Jahren passiert Teil 4: Die 80er-Jahre Zusammengestellt von Dietmar Fund Anfang der 80er Jahre kam eine erste „Zweite Phase“ ins Gespräch, während eine Gebührenordnung noch nicht ganz abgehakt war. Einige Vorarbeiten der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände (BVF) flossen auch in den 80er Jahren in die Arbeit des noch ganz in Bonn angesiedelten Bundesverkehrsministeriums ein. Drei Schwerpunkte waren hier die Zweirad- und die Lkw-Ausbildung und die ersten Gedanken zu einer mehrstufigen Ausbildung von Kraftfahrern, die später unter dem Begriff „Zweite Phase“ intensiv diskutiert worden sind. Jahrgang 1980 FS 1/80 informiert nach S. 16 über Neuerungen bei der Zweiradausbildung, die auch Auswirkungen auf den Fahrschul-Fuhrpark haben. Über die in Vorbereitung befindliche Richtlinie zur Feststellung der Prüfungstauglichkeit von Pkw berichtet FS 3/80, S. 86. Das Curriculum für die Zweiradausbildung stellt Rolf Walther in FS 4/80, S. 132 vor. Am 15.3.80 wählten die Schleswig-Holsteiner Wolfgang Bentzien zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden ihres Verbandes (FS 5/80, S. 172). Ernst Fröhling klagte als Vorsitzender der Bundesvereinigung bei deren Mitgliederversammlung über die nebenberufliche Tätigkeit von Behördenfahrlehrern und Klasse-2-Ausbildungsgänge bei TÜV und Dekra (FS 5/80, S. 178). Im Jahrgang 1980 testet der baden-württembergische Verbands-Aktive Bernd Wolfer diverse Fahrschulmotorräder. Die Richtlinie zur Begutachtung von Doppelbedienungseinrichtungen bringt FS 7/80, S 280. Über den Hamburger Modellversuch zum Mofa 25 berichtet FS 8/80, S. 300. Einen Arbeitskreis Motorradausbildung und einen zur Ausbildung des Fahrlehrernachwuchses bildet der Vorstand der Bundesvereinigung am 4./5. Juli 1980. Außerdem sollte ein Gutachten über die Vor- und Nachteile einer Fahrlehrerkammer und einer Gebührenordnung in Auftrag gegeben werden (FS 8/80, S. 310). Mit dem Slogan „Eröffnen Sie in Kelheim eine Fahrschule!“, inserierte ein Gasthof Kandler in FS 8/80, S. 312. Auf diese Idee würde heute wohl niemand mehr kommen. „BMW unterstützt Ihre Fahrschule. Mit aktuellen Lehrmitteln.“, werben die Bayern in FS 9/80, S. 343. Seinen Ascona-Fahrschulwagen-Spezial, ein voll ausgestattetes Fahrschulauto, und den Fahrschul-Service kündigt Opel in FS 9/80, S. 348 an. VW bewirbt seine Lehrmaterialien im selben Heft auf S. 360. Der EG-Führerschein solle zum 1.1.83, spätestens aber zum 1.1.86 kommen, berichtet FS 9/80, S. 356. Genannt wurden die Fahrerlaubnisklassen A, B, C, D und E. Den Ursachen von Motorradunfällen geht Prof. Dr. Max Danner in FS 9/80, S. 358 weiter nach. Über Vorbereitungsarbeiten zum Start der „Berufsständischen Abrechnungszentrale für Fahrschulen“ berichtet FS 10/80, S. 392. Komplette Full-Service-Verträge für Fahrschulautos bietet AMG Auto Miete GmbH aus Neu-Isenburg in FS 10/80, S. 410 an. Sie schlossen alle Betriebskosten außer den Kraftstoffen mit ein. Über den Theorieunterricht in Klasse 1 informiert die Beilage Blickpunkt in FS 10/80, S. 411. FS 11/80, S. 452 meldet, dass alle Fahrschulwagen, die ab 1.9.80 neu zugelassen werden, Doppelpedale mit ABE brauchen. Hubert Müller und Gerhard von Bressensdorf testeten in FS 11/80, S. 456 das neue Leichtkraftrad Hercules Ultra 80 F. Seit 1.10.80 gilt die Führerscheinpflicht auch für die Klasse 4. Die Fahrlehrerlaubnis für Klasse 4 ist in der für Klasse 1 enthalten (FS 11/80, S. 470). Als Seminarleiter zweier Klasse-1-Fortbildungen in Südtirol trat erstmals der damalige Bezirksvorsitzende Gerhard von Bressensdorf in Erscheinung, unterstützt vom langjährigen 1. stellvertretenden Vorsitzenden Hubert Müller (FS 12/80, S. 484). Auffallend: Während die Firma Haas in den ersten Heften des Jahrgangs noch inseriert hatte, kommt sie am Schluss nicht mehr vor – sie hatte wohl aufgehört. Jahrgang 1981 Mehr als 300 Fahrlehrer besuchten die erste deutsche Fahrlehrer-Basistagung im Verkehrs-Institut Bielefeld (FS 1/81, S. 8). Motorradanhänger bewerben in FS 1/81, S.32/33 Falkenhorst Fahrzeugbau, 4995 Stemwede 1, und Bauer & Flach, Kleinaspach. Über Klasse-1-Seminare des Fahrlehrer-Verbandes Nordrhein berichtete FS 2/81, S. 34. Mit dabei: Arno Wymar und der damalige Amtsrat Horst Venhoff. Wie kann die Fahrlehrerschaft zu einer Kammer und/oder einer Gebührenordnung kommen? Das beschäftigte den Vorstand der Bundesvereinigung. Rolf Walther legte dort das Manuskript des Leitfadens für die Kraftradausbildung vor (FS 3/81, S. 74) vor. Über die Funk-Ausbildung in Klasse 1 diskutierte der Arbeitskreis der Berliner Klasse-1-Fahrlehrer. Es ging beispielsweise um die Frage, ob der Fahrlehrer voraus oder hinterher fahren solle (FS 4/81, S. 114). Seit 1.4.81 müssen Fahrerlaubnisbewerber nachweisen, dass sie die Grundzüge der energiesparenden Fahrweise beherrschen (FS 4/81, S. 132). Karl Engels wird am 21.3.81 zum Vorsitzenden des Fahrlehrerverbandes Westfalen gewählt (FS 5/81, S. 160). Er löst Werner Hilff ab. Gerhard von Bressensdorf wird 1981 zum Vorsitzenden des Landesverbandes Bayerischer Fahrlehrer gewählt. Von Bressensdorf, der seit 1962 Fahrlehrer und seit 1979 Bezirksvorsitzender ist, löst Fritz Rauscher ab, der das Amt seit 1968 innehatte (FS 5/81, S. 164). Über die praktische Grundausbildung in Klasse 1 informiert FS 5/81, S. 173. Einen neu eingeführten Pressedienst stellt die Bundesvereinigung in FS 5/81, S. 181 vor. „Grundlagen für Fahrschulfunk geschaffen“, meldete die Bundesvereinigung in FS 6/81, S. 226. Die Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung verabschiedete das verkehrspädagogische Konzept des Verbandes für die Aus- und Weiterbildung von Kraftfahrern (FS 7/81, S. 256). Es enthielt beispielsweise die Forderung nach einer zweiten Ausbildungsphase mit Prüfung, die sich nach einjähriger Fahrerfahrung an die Grundausbildung anschließen sollte. „Richtlinien für die Ausstattung und Überwachung von Fahrschulen“ veröffentlicht FS 7/81, S. 273. Klasse-1-Fortbildungsseminare in den Verbänden Nordrhein, Hessen und Bayern waren Schwerpunkte der Ausgaben 8 und 9/81. Eine „Anti-Streß-Woche für Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer“ kündigte das Deutsche Verkehrs-Pädagogische Institut in FS 9/81, S. 348 an. Seit der Vorstandssitzung der Bundesvereinigung am 10./11.9.81 ist der Landesverband Bayerischer Fahrlehrer wieder mit von der Partie (FS 10/81, S. 366), der 1975 ausgetreten war. Die lang ersehnte „Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge“ konnte FS 10/81, S. 392 veröffentlichen. Seit dem 1.1.82 mussten Fahrschul-Pkw bei der Prüfung „möglichst viertürig“ sein und am Beifahrersitz eine abnehmbare Kopfstütze haben, sofern der Prüfende sonst keine ausreichende Sicht hatte. Außerdem wurden Mindestmaße für den Prüfersitz eingeführt. Über das 50-jährige Jubiläum des Verkehrsverlages Remagen berichtet FS 12/81, S. 472. Jahrgang 1982 FS 2/82, S. 54 bringt die erste große Übersicht über Pkw, die nach der geänderten Richtlinie prüfungstauglich sind. In der Vorstandssitzung am 25./26.1.82 kam die Bundesvereinigung zu dem Ergebnis, es gäbe keine Möglichkeit für die Verwirklichung einer Fahrlehrerkammer und einer Mindest-Gebührenordnung. Der Vorstand drängte ferner das Präsidium des Internationalen Verbandes für Verkehrsschulung und Verkehrserziehung (IVV), eine EG-Gruppe einzusetzen, weil man mit der Arbeit des IVV unzufrieden war (FS 3/82, S. 82). Den „Fahrlehrer des Monats“ suchte Alfa Romeo in FS 5/82, S. 171. Er konnte eine Wochenendreise nach Rom gewinnen, wenn er im Mai, Juni oder Juli 1982 mithalf, den „Fahrschüler des Monats“ zu ermitteln, der je einen Alfasud gewinnen konnte. Bei der 82er-Mitgliederversammlung der Pfälzer wird Rudi Ebel 2. stellvertretender Vorsitzender (FS 6/82, S. 220). „Das Fahren mit Anhänger: Ein paar Fahrstunden wert?“ fragt FS 6/82, S. 238. Wie die Klasse-1-Fahrlehrer in Bayern ausgestattet sind und arbeiten, zeigte FS 8/82, S. 300 im Anschluss an eine Befragungsaktion des bayerischen Landesverbandes. Wie FS 9/82, S. 338 meldet, ist die Bundesvereinigung aus dem IVV ausgetreten und hat einen Satzungsentwurf für die Gründung einer Europäischen Fahrlehrer-Föderation erarbeitet. „Werden Sie einer von uns!“: Mit diesem Slogan sprach die Bausparkasse Mainz in FS 10/82, S. 413 Fahrlehrer an. Der Bericht über die Mitgliederversammlung des Fahrlehrerverbandes Berlin vom 25.9.82 gibt Aufschluss über die berufsständische Diskussion, die damals über die beiden Verrechnungsstellen dvf und BAF geführt worden ist. Peter Glowalla drohte ein ernsthaftes Zerwürfnis an (FS 11/82, S. 420). „Der Berufsstand muss sich gegen Einmischung wehren“, heißt es dazu in FS 11/82, S. 431. Am 28.9.82 wird im Verkehrs-Institut Bielefeld die Europäische Fahrlehrer-Assoziation (EFA) gegründet. Ihr erster Vorsitzender wird Rolf Walther aus Hamburg (FS 11/82, S. 428), stellvertretender Vorsitzender der langjährige spätere Vorsitzende der EFA, Georges van Aerschot aus Belgien. Wie FS 12/82, S. 468 berichtet, gibt es ab 1.1.83 einen Automatik-Eintrag im Führerschein, wenn die Prüfung auf einem Automatik-Wagen gemacht worden ist. Bewerber für Klasse 2 müssen ab diesem Datum ein Gesundheitszeugnis eines Arztes vorlegen. Mit einem „Berliner Modell“ wollte der dortige TÜV schon 1982 das Prüfungsklima verbessern. Es umfasste eine Schulung von Prüfern und Fahrlehrern sowie ein „Anti-Stress-Training“ für den Prüfling (FS 12/82, S. 480). Zenith Data Systems und Olympia Boss treten als erste Computer-Hersteller mit Fahrschul-Verwaltungssoftware in FS 12/82, S. 497/498 werblich in Erscheinung. Jahrgang 1983 Bei der Vorstandssitzung der Bundesvereinigung im November 1982 kam es wegen der Beratertätigkeit des damaligen Berliner Landesvorsitzenden zum Eklat. Stein des Anstoßes waren Bestrebungen des Inkassobüros dvf, ein Franchise-System der „Gelben Fahrschulen“ aufzuziehen (FS 1/83, S. 6). Einen Langzeittest, bei dem fünf Fahrlehrer mehrere Monate lang einen BMW 318i testen konnten, schreibt FS 1/83, S. 26 aus. Unter den Testern: der spätere hessische Landesvorsitzende Willy Heisch (FS 3/83, S. 101). In einer Eilmeldung lässt der bayerische Vorsitzende Gerhard von Bressensdorf in FS 2/83, S. 40 wissen, es bestünden gute Chancen einer Einigung zwischen dem Berliner Verband und der Bundesvereinigung. Neue Grundfahrübungen für die Zweiradklassen kündigt FS 2/83, S. 42 an. Über die Umsetzung der 1. EG-Führerscheinrichtlinie in deutsches Recht berichtet FS 3/83, S. 86. Neben einer Gesundheitsuntersuchung für Klasse 2 wurde unter anderem das Mindestalter für Busfahrer von 23 auf 21 Jahre herabgesetzt. Die Fahrschulsekretärinnen sprach am 26.1.83 der Berliner Landesverband erstmals mit einem Seminar an (FS 4/83, S. 126). In FS 5/83, S. 168 kritisiert Peter Glowalla stark den Inhalt der „Fahrschule“ und listet genau auf, wie wenig wichtige Inhalte die Zeitschrift seines Erachtens bringe. Deshalb werde der Landesverband den Bezug kündigen. Bei der Mitgliederversammlung des Fahrlehrerverbandes Nordrhein am 19.3.83 wird ¬Arnold Wymar zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Er war bis dahin als Bezirksvorsitzender und als Referent bei Motorrad-Veranstaltungen angenehm aufgefallen (FS 5/83, S. 172). Eine Gebührenordnung für Fahrschulen und eine zweite Ausbildungphase für angehende Fahrlehrer forderte der Vorstand der Bundesvereinigung am 7./8.4.83 (FS 5/83, S. 180). Der zunehmenden Kritik an der „Fahrschule“ begegnete der Vorstand mit der Gründung eines Arbeitskreises Fachzeitschrift, dem Gerhard von Bressensdorf, Peter Glowalla, Gebhard Heiler und der Westfale Günter Wellpott angehörten. Zum 11.5.83 übernimmt die dvf-Firmengruppe die Geschäftsanteile der Berufsständischen Abrechnungszentrale für Fahrschulen (BAF). Für die Klärung berufsständischer Fragen werde die Bundesvereinigung der dvf-Firmengruppe zur Verfügung stehen. Das meldet FS 6/83, S. 230. Auf ihrer Vorstandssitzung am 8./9.8.83 setzt sich die Bundesvereinigung für die Pläne des Bundesverkehrsministeriums ein, einen Stufenführerschein für Krafträder und einen Führerschein auf Probe für Fahranfänger einzuführen. Außerdem ging es um Anforderungen an Funkanlagen für Klasse 1 und um die Neugestaltung der Klasse-2-Ausbildung, die damals wohl noch auf Omnibussen zulässig war (FS 9/83, S. 326). Mit FS 10/83, S. 370 ist Hilmar Schmitt stellvertretender Chefredakteur geworden. Über Klasse-2-Ausbildungspläne von TÜV und Dekra berichtet FS 11/83, S. 402. „Mindestanforderungen für Funkanlagen wurden festgelegt“, meldet FS 11/83, S. 407. Es handelte sich um das Ergebnis einer Arbeitsgruppe der Bundesvereinigung. Mehr dazu brachte ein Interview mit Gerhard von Bressensdorf in FS 2/84, S. 16. Eckdaten für die Lkw-Ausbildung erarbeitete der Vorstand der Bundesvereinigung am 4./5.11.83 (FS 12/83, S. 446). Jahrgang 1984 (Ab diesem Jahrgang wird „Fahrschule“ endgültig nicht mehr durchpaginiert!) Der Bildschirmtext der Deutschen Bundespost war das Thema einer Fortbildung des Fahrlehrer-Verbandes Berlin im November 1983. Schon damals skizzierte Peter Glowalla, wie sich Fahrschulen im neuen Medium präsentieren können (FS 1/84, S. 6). Aus Bonn wird in FS 1/84, S. 18 angekündigt, die Teilnahme am Theorieunterricht solle bald Pflicht werden. Neben weiteren Verschärfungen der Ausbildung wollte das Bundesverkehrsministerium auch den Realschulabschluss zur Eingangsvoraussetzung für Fahrlehrer machen und den Prüfungsausschuss für Fahrlehrer um einen Pädagogen oder Psychologen erweitern. „Btx – Stichwort oder Reizwort?“, fragt FS 2/84, S. 20. Ein Fahrschüler-Magazin der Bundesvereinigung namens „Steig ein“ kündigte FS 3/84, S. 14 an. Es sollte zehnmal pro Jahr erscheinen und von Fahrschulen abonniert werden. „Fahrschulcomputer auf dem Weg in den Markt“, meldet FS 4/84, S. 18. Angetreten war Dr. Hannes Hopmann, der heute immer noch Fahrschul-Software anbietet. Bei der Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung wies „Öffentlichkeitsarbeiter“ Gebhard Heiler darauf hin, dass das Fahrschülermagazin „Steig ein“ mit 40.000 Exemplaren Auflage noch nicht über den Berg sei (FS 6/84, S. 16). Abgelehnt wurde der Antrag, den geschäftsführenden Vorstand um einen dritten Stellvertreter zu erweitern. Mit FS 6/84, S. 20 taucht Hans-Jürgen Götz als Redakteur auf. Auf ihrem 1. europäischen Kongress forderte die Europäische Fahrlehrer-Assoziation, die eher noch zunehmende Laienausbildung in Europa müsse eingedämmt werden (FS 6/84, S. 33). Bei der Mitgliederversammlung des hessischen Landesverbandes am 2.6.84 wurde der Bezirksvorsitzende Willy Heisch 2. stellvertretender Vorsitzender (FS 7/84, S. 17). Bei einem Klasse-1-Fahrtraining des Fahrlehrerverbandes Schleswig-Holstein macht Heiner Göttsche als Instruktor erstmals von sich reden (FS 7/84, S. 27). Über das Verkehrssicherheitsprogramm der Bundesregierung beriet der Vorstand der Bundesvereinigung am 2./3.10.84 zum zweiten Mal in Hohenroda. Dabei stellte das Gremium auch fest, dass „profunde Sachkenntnisse über die kaufmännische Betriebsführung“ in die anzustrebende zweite Phase der Fahrlehrer-Ausbildung integriert werden sollten (FS 11/84, S. 23). Auch die „Fahrschule“ war damals wieder der Kritik ausgesetzt. Über die IFMA 1984 berichtete Arno Wymar mit dem Motorradreferenten seines Landesverbandes in FS 11/84, S. 28. Jahrgang 1985 Aus dem Impressum von FS 1/85, S. 4 hat sich Hans-Jürgen Götz schon wieder verabschiedet. Wie FS 2/85, S. 18 berichtet, erprobt nach Baden-Württemberg auch Hessen in einem Modellversuch, wie sich Fahrschulwagen mit einem Dachschild auf die Verkehrssicherheit auswirken. Ab 1.10.85 müssen auch Mofafahrer einen Helm tragen. Außerdem brauchen Mofafahrer ab diesem Termin eine theoretische und praktische Ausbildung in einer Schule oder einer Fahrschule sowie eine Mofa-Prüfbescheinigung (FS 3/85, S. 8). Über die Qualifikation von Zweiradfahrern dachte Gebhard Heiler in FS 3/85, S. 13 nach. Delta-Doppelbedienungen bewirbt die Wolfsburger Delta Ingenieur-Technik GmbH in FS 3/85, S. 24. (Auch in FS 5/85, S. 10, FS 9/85, S. 15). Mit einem Artikel über die neuen Mofa-Vorschriften in FS 4/85, S. 29 macht sich Dr. J¬oachim Jagow erstmals bei der Fahrlehrerschaft bekannt. Als Dressman für eine „Fahrlehrer-Allwetter-Weste“ stellt sich der spätere Verlagsleiter Klaus Hengster in FS 4/85, S. 49 zur Verfügung. Über eine „Kaufhaus-Fahrschule“ bei Hertie in Berlin diskutierte der Vorstand der Bundesvereinigung im März 1985 (FS 5/85, S. 18) und auch die Mitgliederversammlung des Fahrlehrer-Verbandes Berlin (S. 25). Ein Gutachten über vier EDV-Anlagen für Fahrschulen fertigte Willy Hövener an, der damalige stellvertretende Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes Westfalen (FS 6/85, S. 14). „Norddeutsche Fahrschule und Reisebüro sucht Zusammenarbeit mit Fahrschulinhabern im gesamten Bundesgebiet. Hohe Verdienstmöglichkeiten.“ Das verspricht eine Kleinanzeige in FS 6/85, S. 39. Mit einem doppelseitigen Inserat in FS 7/85, S. 4 tritt die Leutenbacher Verrechnungsstelle AVS auf den Plan. Der Fortbestand der Fahrschüler-Zeitschrift „Steig ein“ sei gefährdet, wenn es nicht gelinge, mehr Abonnements zu verkaufen, sagte Gebhard Heiler während der Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung am 1./18.05.85 (FS 7/85, S. 13). In der Vorstandssitzung Mitte 1985 lehnt die Bundesvereinigung den „Hilfsfahrlehrer“ ab. Nach einem Referentenentwurf sollte eine Ausbildungsfahrlehrerlaubnis kommen. Mit ihr sollte der künftige Fahrlehrer drei Monate nach Ausbildungsbeginn in einer amtlich anerkannten Ausbildungsstätte praktische Erfahrungen sammeln können (FS 9/85, S. 21). Außerdem setzte sich der Vorstand für eine Zweigstellen-Begrenzung ein. Mit einer Kleinanzeige in FS 9/85, S. 39 macht der Fahrlehrer Schirrmann erstmals auf sein im Entstehen begriffenes Ausbildungs- und Trainingsprogramm Formel S aufmerksam. Ein „FAS Fahrschul-Abrechnungs-Service“ aus Waiblingen-Bittenfeld macht in FS 10/85, S. 9 erstmals auf sich aufmerksam (und ist auch in FS 1/86, S. 13 noch dabei). Sein 50-jähriges Jubiläum feierte der Verlag Heinrich Vogel im Beisein des Bundesverkehrsministers Dr. Werner Dollinger und fast des gesamten Vorstands der Bundesvereinigung (FS 12/85, S. 10). Für ein Agenturnetz für Verkauf, Vorführung und Vermietung von Wohnmobilen suchte das Deutsche Verkehrs-Pädagogische Institut in FS 12/85, S. 13 Fahrlehrer als Partner. Jahrgang 1986 Auf den Inhaltsseiten wird ab FS 1/86 unter der Redaktion ein Robert Krichenbauer geführt – im Impressum hingegen nicht. Krichenbauer wird ab FS 4/86 als Chef vom Dienst bezeichnet. Bei der letzten Vorstandssitzung des Jahres 1985 beschloss die Bundesvereinigung, sich gegen die Erteilung einer Fahrschulerlaubnis an BGB-Gesellschaften auszusprechen (FS 1/86, S. 16). Mit einer Fahrschule an der Technischen Universität mussten sich die Berliner Verbandsfahrlehrer herumärgern (FS 1/86, S. 18). Ab 1.4.86 müssen Ausbildungsfahrzeuge in Klasse 3 eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h haben. Sie dürfen bei der Fahrausbildung mit dem amtlichen Fahrschule-Schild an Vorder- und Rückseite gekennzeichnet sein. Ein solches Schild kann auch quer zur Fahrtrichtung auf dem Dach angebracht sein (FS 1/86, S. 25). Die zweite Tür rechts ist bei Prüfungsfahrzeugen der Klasse 3 noch nicht vorgeschrieben. Ausbildungsfahrzeuge für Klasse 2 werden neu definiert. Neue Fahrzeuge für Klasse 2 stellt FS 3/86, S. 10 vor. Über „Möglichkeiten und Grenzen der Rationalisierung im geltenden Fahrschulrecht“ informiert FS 3/86, S. 22 im Anschluss an eine Fortbildungsreihe. Es ging dabei unter anderem um die gemeinsame Nutzung von Ausbildungsfahrzeugen und um Kooperationen. Eine Übersicht über die neuen Anforderungen an Prüfungsfahrzeuge und die Termine des Inkrafttretens bringt FS 3/86, S. 35. Zum 1.4.86 kommt der Stufenführerschein für Zweiräder, für den sich die Bundesvereinigung lange eingesetzt hat (FS 4/86, S. 38). Der neue rosa EG-Führerschein wird in der Bundesrepublik 1986 eingeführt, jedoch ohne die neuen Fahrerlaubnisklassen (FS 4/86, S. 41). Zum 1.1.87 sind neue Prüfungsfahrzeuge in den Klassen 1, 1a und 3 vorgeschrieben. Außerdem werden die Funkbegleitung und das Hinterherfahren hinter dem Motorradfahrschüler Pflicht (FS 4/86, S. 39). Schon 1986 versuchte der ADAC, Fahrschüler über eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft zu ködern (FS 5/86, S. 22). Bei der Mitgliederversammlung der Pfälzer am 14.7.86 wird Rudi Ebel zum 2. Vorsitzenden gewählt (FS 6/86, S. 24). Zum 1.11.86 wird der Führerschein auf Probe für die Klassen 1, 1a, 1b und 3 eingeführt (FS 7/86, S. 28). Wie Ford Fahrschulen hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung berät, schildert FS 8/86, S. 8. Auch der Landesverband Bayerischer Fahrlehrer gründete 1986 einen Arbeitskreis der Lkw-Ausbilder, den es in Baden-Württemberg schon gab (FS 9/86, S. 16). Schon damals kam der Gedanke einer Kooperation auf. Seit 1.11.86 müssen Fahrschüler am theoretischen Unterricht teilnehmen (FS 11/86, S. 8). Mit FS 12/86 verschwindet der Chef vom Dienst wieder aus dem Impressum, in FS 3/87 taucht Robert Krichenbauer wieder als CvD auf. Jahrgang 1987 Mit dem Schlagwort „Führerschein auf Raten“ bietet die Deutsche Verrechnungsstelle für Fahrschulen (dvf) eine Führerschein-Finanzierung für Fahrschüler an (FS 1/87, S. 16). „Große Bedenken“ gegen die Entwicklung eines Simulators für Ausbildungs- und Forschungszwecke äußerte der Vorstand der Bundesvereinigung Ende 1986. Ein Münchner Hersteller wollte damals mit dem TÜV Rheinland einen Simulator in der Erstausbildung einsetzen (FS 1/87, S. 22). Über die Formel-S-Ausbildung von Wolfram Schirrmann berichtet FS 3/87, S. 16. In FS 4/87, S. 27 berichtet Gebhard Heiler, dass auf der Vorstandssitzung erneut über die Zeitschrift „Fahrschule“ diskutiert worden sei. Wegen zu geringem Informationsgehalt und der unzureichenden Erfüllung berufspolitischer Aufgaben werde den Landesverbänden empfohlen, das Sammelabo zu kündigen und eine Alternative zu entwickeln. Bei der Vorstandssitzung der Bundesvereinigung am 10./11.3.87 wurde der erste Fahrschüler-Ausbildungspass präsentiert. Schon damals unterstützte VW das Werk (FS 4/87, S. 27). Mit seinem „Gießener Modell“ wollte das dortige Regierungspräsidium Fahrschulen zu klareren Preisangaben bewegen (FS 4/87, S. 12). FS 5/87, S. 36 bringt die neue Prüfungsrichtlinie, deren Anlage 6 ab Oktober 1987 neue Vorgaben für prüfungstaugliche Pkw bringt (S. 51). Mit FS 6/87 verschwindet der CvD wieder aus dem Impressum. Rallye-Weltmeister Walter Röhrl wirbt in FS 6/87, S. 24 für das neue Lehrmaterial des Verlages Heinrich Vogel. Das gefiel dem Hamburger Vorsitzenden Rolf Walther gar nicht (FS 9/87, S. 34). Über ein von 50 auf 27 PS umschaltbares Fahrschulmotorrad wurde bei der Mitgliederversammlung des Fahrlehrerverbandes Niedersachsen kontrovers diskutiert (FS 6/87, S. 36). Das Muster der seit 1.1.87 vorgeschriebenen Ausbildungsbescheinigung gibt FS 6/87, S. 42 bekannt. Ernst Fröhling bereitete die Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung 1987 darauf vor, dass ein prüfungstauglicher Pkw wohl bald vier Türen haben müsse (FS 7/87, S. 20). Auf der Basis des Leitfadens für Klasse 1 solle ein Curriculum für diese Klasse analog zum bereits vorliegenden in Klasse 3 erarbeitet werden, hieß es im Bericht über die Versammlung. Erstmals wurde ein Etat für Öffentlichkeitsarbeit eingestellt, der 12.000 Mark umfasste. Zum Vorsitzenden des Landesverbandes der hessischen Fahrlehrer wird 1987 der bisherige 1. stellvertretende Vorsitzende Willy Heisch gewählt. Seit dem 27.2.87 gelten für „Leichtmofas“ Ausnahmen von der StVZO. Beispielweise muss man auf ihnen keinen Helm tragen (FS 8/87, S. 37). Die vorgesehenen Grundfahraufgaben für Klasse 1 diskutierte FS 9/87, S. 10. Ein Rabattabkommen mit der Autovermietung Interrent schloss die Bundesvereinigung am 1.9.87 für ihre Mitglieder (FS 9/87, S. 19). Mit der Landesverkehrswacht zusammen wirbt der Fahrlehrerverband Hamburg 1987 unter Fahranfängern für ein Sicherheitstraining (FS 9/87, S. 23). Einen Lkw-Pool für Klasse 2 einzurichten, versprach Iveco Magirus in FS 11/87, S. 5. Es ging um Miet-Lkw für Fahrschulen. Der Geschäftsführende Vorstand der Bundesvereinigung schlug der Bundeswehr 1987 mehrmals vor, Modellversuche zur zivilen Fahrausbildung von Soldaten einzurichten (FS 11/87, S. 22). Ein nordrhein-westfälischer Schulpolitiker brachte damals erneut den Gedanken auf, die Schule müsse auf die Fahrausbildung vorbereiten. Auf Anregung des Ulmer Fahrlehrers Franz Bayer kommt vom 5. bis 7.10.87 ein erstes Klasse-2-Seminar für Fahrlehrer bei Iveco Magirus zustande (FS 11/87, S. 24). Komplett ausgestattete Fahrschul-Lkw präsentierte Daimler-Benz auf der IAA 1987. Außer Doppelkabine und Doppelpedalerie hatten sie einen Mittelsitz für den Prüfer (FS 12/87, S. 30). Jahrgang 1988 Nach zehn Jahren überarbeitete der Vorstand der Bundesvereinigung am 30.11.87 die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (FS 1/88, S. 20). Ab dem 1.4.88 muss in Klasse 2 grundsätzlich auf einem Sattel- oder Gliederzug ausgebildet werden. Ausnahme: die Kurzausbildung zum Omnibusfahrer (FS 1/88, S. 23). Klasse-2-Fortbildungen bot der Fahrlehrerverband Nordrhein 1988 zusammen mit Ford an (FS 1/88, S. 26). MAN schickte 1988 Fahrschul-Lkw auf Tournee (FS 3/88, S. 5). Am 23.1.88 wird Wolfgang Bentzien zum Vorsitzenden des Fahrlehrerverbandes Schleswig-Holstein gewählt. Sein bisheriges Amt als 1. Stellvertreter nimmt Heinrich Göttsche ein (FS 3/88, S. 27). Ein Positionspapier zur Verbesserung der Fahrlehrerausbildung verabschiedete der Vorstand der Bundesvereinigung am 18./19.2.88. Er forderte eine Anhebung der Zugangsvoraussetzungen sowie eine längere und zweiphasige Ausbildung (FS 4/88, S. 25 und FS 6/88, S. 10)). Die neuen Grundfahraufgaben in Klasse 2 zeigt FS 5/88, S. 18. Am 23.4.88 wird Rudolf Ebel zum Vorsitzenden des Verbands der Kraftfahrlehrer Pfalz gewählt, bis dato 1. stellvertretender Vorsitzender (FS 6/88, S. 34). Auf eine neue Auslegung der Grundfahrübungen in Klasse 1 einigten sich der Bund und die Bundesländer 1988 (FS 6/88, S. 51). Die StVO-Reform von 1988 bringt unter anderem einige neue Verkehrsschilder (FS 6/88, S. 54). Der Hamburger Vorsitzende Rolf Walther blickte in FS 7/88, S. 16 auf die Geschichte des Fahrlehrerberufes zurück. Die Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung wählte am 3.6.88 Gerhard von Bressensdorf zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden. Sein Vorgänger Gebhard Heiler stellte sich nicht mehr zur Wahl, blieb aber Pressereferent der Bundesvereinigung (FS 7/88, S. 24). Auch 1988 führte der Fahrlehrerverband Nord¬rhein Klasse-2-Fortbildungen in der Kundendienstschule Köln durch. Wie es in FS 7/88, S. 40 heißt, tat er dies seit 1982 regelmäßig. Die Vöhringer Firma HMG schlug in FS 8/88, S. 61 vor, sich durch eine „zukunftsorientierte Sicherheitsausbildung Klasse 3 mit Pkw-Anhänger-Schulung“ von Kollegen abzuheben. Sie bot dazu einen Fahrschulanhänger an, der sich auch hervorragend als Werbeträger eignen sollte (obwohl er laut Zeichnung flach war!). Den curricularen Leitfaden der Bundesvereinigung für Klasse 1 präsentierte FS 9/88, S. 22 in einem Interview mit Rolf Walther. Die ab Oktober 1988 geforderten Grundfahrübungen in Klasse 2 führten der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg und Vertreter der TÜV Stuttgart und Baden im Sommer 1988 der Presse vor (FS 10/88, S. 8). Einen Fahrschul-Lkw von Renault meldete FS 10/88, S. 14. „99 Tips und Tricks für Führerschein-Neulinge“ versprach eine Broschüre des Shell Fahrschul-Service in FS 10/88, S. 15. Am 1.11.88 löst Gerhard von Bressensdorf den bisherigen Pressesprecher der Bundesvereinigung, Gebhard Heiler, ab. Heiler hatte um eine Ablösung gebeten (FS 11/88, S. 17). In FS 12/88, S. 5 bewirbt Scania seinen Hauber als Fahrschul-Lkw. Zum Erfahrungsaustausch mit Kollegen in der DDR und in Polen war eine Gruppe bayerischer Fahrlehrer im Herbst 1988 unterwegs (FS 12/88, S. 21). Auf Initiative der „Fahrschule“ trafen sich im Herbst Offiziere der Bundeswehr, Gerhard von Bressensdorf und Gebhard Heiler, um über die Fahrausbildung bei der Truppe zu diskutieren (FS 12/88, S. 24). Jahrgang 1989 Nach langer Werbepause taucht in FS 1/89, S. 21 wieder eine Anzeige der Delta Ingenieur-Technik GmbH aus Wolfsburg auf, die für Doppelbedienungen in VW-Fahrzeugen wirbt. An die Stelle des verstorbenen Hamburgers Rolf Walther wählte die Mitgliederversammlung Gebhard Heiler zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden (FS 1/89, S. 22). Bei einer Fortbildung des Fahrlehrerverbandes Hamburg im Oktober 1988 taucht der spätere langjährige Vorsitzende Hans-Detlef Engel erstmals öffentlich auf. Er referierte über Kleingruppenarbeit (FS 1/89, S. 23). Die Scania-Hauber zweier Fahrlehrer aus Grassau und Mühldorf präsentierte Theo Delfried Domina in FS 1/89, S. 28. Im Frühjahr 1989 wird Hans-Detlef Engel 1. stellvertretender Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Hamburg (FS 4/89, S. 26). Ab 1.1.90 wird bei der Erteilung der Fahrschul- oder Zweigstellenerlaubnis eine neue Ausstattungsrichtlinie zugrunde gelegt (FS 4/89, S. 40). Bei der Mitgliederversammlung des Landesverbands der Fahrlehrer Saar e. V. wird der damalige 1. stellvertretende Vorsitzende Günter Henne einstimmig zum Vorsitzenden gewählt (FS 6/89, S. 20). Die Mitglieder des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg wählen am 22.4.89 Peter Tschöpe zum 3. Vorsitzenden (FS 6/89, S. 20). FS 7/89, S. 4 meldet, dass Lkw mit der Schalthilfe EPS auch als Prüfungsfahrzeuge der Klasse 2 eingesetzt werden dürfen. Einen Vorschlag für eine zweite Führerscheinrichtlinie legte die EG-Kommission am 13.1.89 vor (FS 7/89, S. 10). Wie FS 11/89, S. 14 berichtet, konnten 1989 Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken ihren Führerschein im Gefängnis machen. Wie sind die neuen Bestimmungen zur Klasse-2-Ausbildung bei bayerischen Fahrlehrern aufgenommen worden? Darüber informierte FS 12/89, S. 16. Mit einem Bericht über eine Fahrschul-Aktion von Ford auf Mallorca tritt Ralf Schütze an (FS 12/89, S. 26).
Die Jahrgänge 1990 bis 1999
60 Jahre „Fahrschule“ Das ist in den ersten 60 Jahren passiert Teil 5: Die 90er-Jahre Zusammengestellt von Dietmar Fund Immer wieder entdecken fremde Branchen die Fahrlehrer als Geschäftspartner. So war es auch zu Beginn der 90er Jahre, als verschiedene neue Abrechnungsstellen zu den bereits etablierten hinzustießen. Viel wichtiger für die berufsständische Diskussion war aber die Integration der Fahrlehrer aus den neuen Bundesländern. Sie war nach dem Aufkommen der Bundeswehr in den 50er Jahren und der Anti-Baby-Pille mit nachfolgendem Geburtenrückgang in den 60er Jahren der dritte wichtige Meilenstein in der Entwicklung des Fahrschulwesens in Deutschland. Jahrgang 1990 Das „Lichtwarngerät“ Skylux der Hamburger Firma Pohlmann & Roesler, so die Anzeige in FS 1/90, S. 18, sollte Autofahrer rechtzeitig daran erinnern, das Fahrlicht einzuschalten. Die 10. Verordnung zur Änderung der StVO bringt FS 1/90, S. 37 (unter anderem mit neuen Verkehrszeichen für Zonen mit Tempo 30 und eingeschränkte Halteverbote). Einen Betriebsvergleich unter Fahrschulen startet die Zeitschrift mit einem Fragebogen in FS 2/90, S. 12. Über die EG-Führerscheinrichtlinie informiert FS 4/90, S.12. Mit dem Bericht über die Hamburger Mitgliederversammlung in FS 4/90, S. 30 halten die neuen Bundesländer Einzug in der Fachzeitschrift. Damals war eine Delegation aus der Partnerstadt Dresden an der Waterkant. Bei der Mitgliederversammlung des Fahrlehrer-Verbands Schleswig-Holstein wird Bernd Arndt 2. stellvertretender Vorsitzender (FS 5/90, S. 20). Alfons Wahlich wurde am 23.3.90 bei der Mitgliederversammlung des Fahrlehrer-Verbands Westfalen zum 3. Vorsitzenden gewählt (FS 5/90, S. 26). Orientierungstage für DDR-Fahrlehrer bot das Verkehrs-Institut Bielefeld von Juni bis August 1990 (FS 6/90, S. 2). Mit einer Satzungsänderung öffnete sich die Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung 1990 für Fahrlehrer-Verbände auf dem Gebiet der DDR (FS 6/90, S. 20). Als „Großraumbüro mit Telefonanschluss“ pries Fiat den Tipo, bei dem es auch eine Leasing-Komponente für das Autotelefon gab (FS 7/90, S. 4). „Fahrlehrer im Aufbruch“, betitelt FS 7/90, S. 12 eine Story über die Info-Tour des Verlages Heinrich Vogel durch die ehemalige DDR. In FS 7/90, S. 15 startet die Verkehrssicherheitsaktion „17 +1“. Bundesvereinigung, Deutsche Verkehrswacht und Fiat luden Fahrschüler zum Fragebogen-Wettbewerb mit anschließenden fahrpraktischen Wettbewerben auf Landes- und Bundesebene ein. Mehr dazu auch in FS 7/90, S. 32. Am 19.5.90 wird Heinz Helm zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden des Landesverbandes der Hessischen Fahrlehrer gewählt (FS 7/90, S. 19). Gebhard Heiler berichtete dort von 2.000 wirklichen Fahrlehrern in der ehemaligen DDR und von rund 15.000 „Fahrausbildern“, die nur eine Schnellbleiche genossen hätten. Die Mitgliederversammlung des Fahrlehrerverbands Nordrhein wählte 1990 Arnold Wymar einstimmig zum Vorsitzenden und Achim Müller zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden (FS 8/90, S. 22). Im Sommer 1990 formierte sich der Sächsische Fahrlehrerverband und beschloss den Beitritt zur Bundesvereinigung (FS 8/90, S. 28). Am 7./8.8.90 nimmt der Vorstand der Bundesvereinigung vier DDR-Landesverbände neu auf: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Mit dabei: die Vorsitzenden Alfred Claus und Georg Lisewitzki (FS 9/90, S. 18). Über das „Verkehrsrecht im Einigungsvertrag“ berichtet FS 10/90, S. 34. Am 2.10.1990 startet ein Modellversuch in München und in Sigmaringen, bei dem Soldaten von zivilen Fahrlehrern in Klasse 2 ausgebildet werden (FS 11/90, S. 26). Eine neue Ausbildungsbescheinigung schließt ab 1.10.1990 auch die praktische Grundausbildung ein, während bis dahin nur die Sonderfahrten bescheinigt werden mussten (FS 11/90, S. 30). Am 5./6.11.90 nimmt der Vorstand der Bundesvereinigung als letztes Mitglied den Thüringer Fahrlehrerverband auf (FS 12/90, S. 22). Jahrgang 1991 Im Impressum von FS 2/91, S.6 taucht Ralf M. Schütze erstmals als Redakteur auf. Seit dem 1.1.91 bieten die im Verband der Automobilindustrie und dem Verband der Importeure von Kraftfahrzeugen organisierten Pkw-Hersteller Neuwagenkäufern einen Gutschein für ein kostenloses Sicherheitstraining an. Er kann bei Trainings von Partnern des Deutschen Verkehrssicherheitsrates eingelöst werden (FS 2/91, S. 6). Fiat, Deutsche Verkehrswacht und Bundesvereinigung setzen 1991 die 1990 begonnene Verkehrssicherheitsaktion „17+1“ fort, die sich an Fahrschüler richtet (FS 2/91, S.16). Am 16.2.91 schließen sich die beiden sächsischen Fahrlehrerverbände zum Landesverband Sächsischer Fahrlehrer zusammen (FS 2/91, S. 28 und FS 3/91, S. 30). Mit im ersten Vorstand: der heutige Vorsitzende Horst Richter. Die „2. EG-Führerscheinrichtlinie kommt bald“, betitelte FS 3/91, S. 26 einen Bericht über die Vorstandssitzung der Bundesvereinigung. Erstmals kam darin auch das Thema „Qualitätssicherung für Fahrschulen“ auf und wurde so kontrovers diskutiert wie heute noch. Gemäß einer Verordnung des Bundesverkehrsministeriums vom 19.12.90 müssen sich Fahrlehrer aus der ehemaligen DDR bis Ende 1992 in einer mindestens vierwöchigen Fortbildung mit dem Fahrlehrerrecht vertraut machen (FS 3/91, S. 36). Am 16. 2.91 tritt im Fahrlehrerverband Hamburg das Führungstrio Hans-Detlef Engel, Gerhard Wenck und Sabine Darjus an (FS 5/91, S. 26). Das bayerische Innenministerium und der Landesverband Bayerischer Fahrlehrer starten im April 1991 das Programm „Jugend fährt sicher“. Es sieht unter anderem vor, dass Fahranfänger erste Fahrerfahrungen nach rund sechs Monaten in zwei Kleingruppensitzungen von je 135 Minuten Dauer aufarbeiten (FS 5/91, S. 8). Das Modell sollte mit zirka 2.000 Fahrschülern in Baden-Württemberg, Bayern und der Pfalz erprobt werden. Bei der Mitgliederversammlung des Landesverbandes Bayerischer Fahrlehrer wird Hansjörg Weichenrieder zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt (FS 5/91, S. 34). Am 20.4.91 wird Peter Tschöpe 2. Vorsitzender des Fahrlehrer-Verbandes Baden-Württemberg. Auf seinen Platz als 3. Vorsitzender rückt der bisherige Motorradreferent Günter Luppart nach. Coca-Cola und Siemens präsentieren in FS 6/91, S. 29 einen kleinen Getränkeautomaten namens Minipom. Das überarbeitete Curriculum der Bundesvereinigung stellt Prof. Dr. Hellmut Lamszus in FS 10/91, S. 32 vor. Mit FS 11/91, S. 8 löst der spätere Verlagsleiter Klaus Hengster den langjährigen Anzeigenleiter Robert A. Braun ab. Die eben verabschiedete EG-Führerscheinrichtlinie stellt FS 11/91, S. 22 vor. Es heißt dabei, die neue Richtlinie müsse bis 1994 in nationales Recht umgesetzt werden. Einen „Fahrstunden-Analog-Rechner“ für den Einbau im Fahrschulwagen präsentiert die Firma Alik Elektronik in FS 11/91, S. 31. Man sollte damit Fahrstunden besser festhalten und verrechnen können. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Fahrlehrerverbandes Sachsen-Anhalt wird Hans-Peter Kamieth zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt (FS 12/91, S. 28). Jahrgang 1992 Neue Verkehrsregelungen in „verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen“ stellt FS 1/92, S. 31 vor (neue Schilder für Zonen). Wie man einer Meldung in FS 1/92, S. 4 und einem Bericht in FS 2/92, S. 14 entnehmen kann, hat die Deutsche Verrechnungsstelle für Fahrschulen (dvf) am 17.12.91 Konkursantrag gestellt. Mit FS 3/92, S. 4 kommt Hans Kitzberger ins Redaktionsteam, schon damals als Motorradexperte. Über die Augsburger Fahrschul-Kette Pro Drive berichtet FS 3/92, S. 18. Selbständige Fahrschulen arbeiteten dabei unter einem Dach und machten über zentrales Marketing von sich reden. Die neue Stufenausbildung gemäß dem überarbeiteten Curriculum der Bundesvereinigung stellt FS 4/92, S. 18 vor. Alfons Wahlich wird 1992 zum 1. Vorsitzenden des Fahrlehrer-Verbandes Westfalen gewählt (FS 5/92, S. 38). Neu gewählt wurden auch der 2. Stellvertreter Sigmar Knoblauch und der 4. Stellvertreter Hans Plitt. Eine Menge modernisierter Verkehrszeichen bringt die StVO-Novelle, die am 1.7.92 in Kraft tritt (FS 6/92, S. 37). Eine Ausbildungsdiagrammkarte für Klasse 3 stellt der Fahrlehrerverband Berlin 1992 vor. Er baut auf Vorarbeiten der Bundesvereinigung auf und beteiligt mit Jochen Lau und Kay Schulte zwei Pädagogen, die noch immer stark in der Fahrlehrer-Weiterbildung tätig sind (FS 8/92, S. 16). Eine Fahrschülerbefragung per Fragebogen durch die Bundesanstalt für Straßenwesen kündigt FS 8/92, S. 26 an. Die Deutsche Bank zeigt sich 1991 und 1992 als großer Inserent mit doppelseitigen, vierfarbigen Anzeigen! Eine neue DVF kündigt FS 9/92, S. 10 an. Der neue, von einer Unternehmensberatung kommende geschäftsführende Gesellschafter möchte die betriebswirtschaftlichen Dienstleistungen für Fahrschulen weiterführen. Umweltbewusstes und Energie sparendes Fahren machte der Fahrlehrerverband Hamburg zum Thema einer offenbar interessanten Fortbildung, über die FS 11/92, S. 34 berichtet. Jahrgang 1993 Am 6.11.92 wählt der Landes-Fahrlehrerverband Bremen Rüdiger Grollmann zum Vorsitzenden (FS 1/93, S. 15). In FS 1/93, S. 19 tritt zum ersten Mal die Abrechnungsstelle für Verkehrsausbildungsbetriebe (AVA), Friedrichsfehn, auf den Plan. Ein Bremsdruckmessgerät des Wilhelmshavener Fahrlehrers Hermann Ahlers stellt FS 1/93, S. 21 vor. Er wollte den Fahrschülern damit beibringen, ihre Bremskraft besser zu dosieren. Mit einer Blindenfahrt erzielte Hamburgs Vorsitzender Hans-Detlef Engel am 18.1.93 eine gute Wirkung in der Öffentlichkeit (FS 2/93, S. 22). Bald tat es ihm Peter Glowalla in Berlin nach (FS 10/93, S. 14). „Zweiphasige Fahrschulausbildung in Sicht“, meldete FS 4/93, S.6 aus Bonn. Es ging um eine erweiterte Grundausbildung mit nachgeschaltetem Erfahrungsaustausch. Neue Grundfahraufgaben für die Klassen 1a, 1b und 4 stellte FS 4/93, S. 18 vor. Ein „Fahrertraining“ in Most als Fortbildung nach § 33a FahrlG bewerben der Thüringer Fahrlehrerverband und die SFG Sächsische Fahrschul GmbH in FS 4/93, S. 21. Seit 1993 musste man beim Aufstieg von Klasse 1a auf 1 keine weitere Ausbildung und Prüfung mehr absolvieren (FS 5/93, S. 4 und S. 22 und S. 28). Seit 1.10.93 müssen Fahrlehrer, die Omnibusfahrer ausbilden möchten, im Besitz des Busführerscheins sein. Voraussetzung für den Busführerschein ist seit damals auch eine gesonderte Ausbildung. Bei der 93er-Mitgliederversammlung des Landesverbandes Sächsischer Fahrlehrer wird Horst Richter zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt (FS 5/93, S. 48). Seit 1.6.93 müssen prüfungstaugliche Pkw mindestens zwei Türen an der rechten Seite haben. „Kabrioletts“ und Fahrzeuge mit nachträglich verringerten Federwegen sind seither als Prüfungsfahrzeuge nicht mehr geeignet (FS 6/93, S. 9). Bis 31.12.97 durfte man vorher begutachtete Pkw noch bei der Prüfung einsetzen. Der heutige Vorsitzende Heinrich Haas wird 1993 zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden des Fahrlehrerverbands Rheinland gewählt (FS 6/93, S. 36). Mit FS 7/93 wird Ralf M. Schütze Chefredakteur der Fahrschule. Er hatte 1979 als Volontär begonnen und war 1991 Redakteur (FS 7/93, S. 6). Der langjährige Chefredakteur Dr. Heinzmartin Nitsche ist seither Senior Editor. Seit Mitte September ist Klaus-Peter Kaufmann Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Mecklenburg-Vorpommern, meldet FS 7/93, S. 38 im Bericht über die Mitgliederversammlung 1993. Einen Referentenentwurf für ein „Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer Gesetze“ meldet FS 9/93, S. 6. Bis es tatsächlich kam, dauerte es noch Jahre. Die neue KOM-Richtlinie stellt FS 10/93, S. 8 vor. Für ihr neues „Fahrschul-Taxameter“ suchte in FS 10/93, S. 55 die Thiel GmbH aus Pulheim Tester. Ein „Rechnungswesen für Fahrschulen“ bietet in FS 12/93, S. 36 „Der Informations-Dienst“ aus Essen an. Jahrgang 1994 Den curricularen Leitfaden für die praktische Pkw-Ausbildung stellte die Bundesvereinigung in FS 1/94, S. 12 vor. Wie der Mitautor Prof. Hellmut Lamszus berichtete, basierte der Leitfaden auf 20-jähriger Vorarbeit. Mit einem Abrechnungsservice für Fahrschulen trat in FS 1/74, S. 19 das Abrechnungs Zentrum Fahrschulen Dr. Güldener GmbH in Stuttgart auf den Plan. Aus Anlass seines 60. Geburtstages würdigt FS 2/94, S. 24 Gebhard L. Heiler. Partner für einen „Fahrschul-Taxameter-Service“ suchte die Pulheimer Firma fatax in FS 2/94, S. 42. Mit einem seiner heutigen Lieblingsthemen, der umweltbewussten Fahrausbildung, setzte sich Peter Glowalla schon 1994 auseinander (FS 3/94, S. 26). Ende 1993 meldet auch die „neue dvf“ Konkurs an, wie FS 3/94, S. 31 berichtet. Am 12.3.94 wird Bernd Rohn zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden des Fahrlehrerverbandes Pfalz gewählt (FS 4/94, S. 18). Einen Computer-Test für Fahrschüler bewarb die Dortmunder Firma Aitec in FS 5/94, S. 5. Er sollte Fahrschulen zusätzliche Einnahmen bringen, nur in Fahrschulen angeboten werden und vom Fahrlehrerverband Westfalen empfohlen sein. „Ernst Fröhling blickt zurück“, ist ein Interview in FS 5/94, S. 6 betitelt. Fröhling stellte sich 1994 nicht mehr zur Wahl. Ernst Templin wird 1994 2. Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Niedersachsen (FS 5/94, S. 30). Am 13.5.94 wählt die Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung ein neues Spitzen-Trio: Gerhard von Bressensdorf wird Vorsitzender, Peter Glowalla 1. und Rudi Ebel 2. stellvertretender Vorsitzender (FS 6/94, S. 12). Ernst Fröhling hatte sich nach 19 Jahren als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl gestellt. Peter Grünwald wird 1994 zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden des Fahrlehrer-Verbandes Rheinland gewählt (FS 6/94, S. 22). Eine Würdigung der Verdienste Gebhard L. Heilers im geschäftsführenden Vorstand der Bundesvereinigung brachte FS 7/94, S. 24. Hans Plitt und Siegmar Knoblauch werben in FS 9/94, S. 41 für das Fahrschüler-Lernprogramm Coach der Firma Aitec. FS 10/94, S. 22 stellt eine ZDF-Serie über den Fahrschulalltag vor. Die Hauptrolle als Fahrlehrer spielt der heutige Münchner Tatort-Kommissar Miroslav Nemec. Auch der Landesverband Bayerischer Fahrlehrer machte schon einmal eine Blindenfahrt, und zwar 1994 (FS 12/94, S. 16). Was bringt das umweltschonende Fahren gemäß dem Curricularen Leitfaden der Bundesvereinigung? Das prüften Pfälzer Fahrlehrer bei einer 94er-Fortbildung (FS 12/94, S. 24). Die Berliner Kollegen taten es ihnen kurz darauf nach (FS 2/95, S. 20). Nachdem die Grundlagen einer professionellen Fahrausbildung geschaffen waren, verbreiterte sich das Spektrum der Themen, mit denen sich die Fahrlehrerverbände beschäftigen mussten, in den 90er-Jahren ganz enorm. Neben Hilfestellungen bei der Zusammenarbeit von Fahrschulen kamen die neue Anhängerklasse BE, Diskussionen über den Einsatz schon weit entwickelter Lkw-Simulatoren und immer wieder „Störmanöver“ benachbarter Institutionen auf die Tagesordnung. Jahrgang 1995 Wie FS 1/95, S. 6 meldet, dürfen Inhaber ausländischer Führerscheine künftig ein Jahr lang in Deutschland fahren, bevor sie sich einer Prüfung unterziehen müssen. Die Bundesvereinigung hat deshalb ein Merkblatt für solche Fahrer erarbeitet, das ihnen nahelegt, sich frühzeitig in einer Fahrschule auf die Prüfung vorzubereiten. Der HUK-Verband und der ADAC fordern 1994 eine zweiphasige Ausbildung und die obligatorische Weiterbildung für alle Kraftfahrer (FS 2/95, S. 14). Ende 1994 machen auch die Thüringer Fahrlehrer eine Blindenfahrt (FS 3/95, S. 20) – ebenso die Hamburger 1995 (FS 5/95, S. 34). „Die neuen EG-Fahrerlaubnisklassen ab dem 1. Jui 1996“ meldet FS 4/95, S. 14. Es sollte noch etwas länger dauern... Ein Merkblatt für umweltschonendes Fahren gibt die Bundesvereinigung 1995 heraus (FS 4/95, S. 21). Den zweiten Praxistest, diesmal mit sechs Seat Ibiza 1,9 TD, startet Fahrschule in FS 4/95, S. 42. Unter Mitwirkung des damaligen schleswig-holsteinischen Verbandsvorsitzenden Wolfgang Bentzien entsteht 1995 das DVR-Programm „Sicher fahren in Land- und Forstwirtschaft“ (FS 5/95, S. 10). Das Curriculum für die Fahrlehrerausbildung, an dem auch die Bundesvereinigung mitgewirkt hat, stellt FS 5/95, S. 12 vor. Reinhard Kendziora wird 1995 zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden des Fahrlehrer-Verbandes Berlin gewählt (FS 5/95, S. 30). Bei der Versammlung wird auch über eine Fahrschule diskutiert, die in ein VW-Autohaus eingezogen war. Ernst Templin löst 1995 in Niedersachsen den Vorsitzenden Ernst Fröhling ab, der dieses Amt 26 Jahre lang innehatte (FS 6/95, S. 18). Am 6.5.95 tritt im Landesverband Sächsischer Fahrlehrer ein neues Führungs-Trio an: Horst Richter als Vorsitzender, Eberhard Böhme als 1. und Bernd Schamel als 2. Vorsitzender (FS 6/95, S. 24). Das Curriculum für die Fahrlehrerausbildung thematisiert in FS 7/95, S. 20 auch Prof. Bruno Heilig. Die Bundesvereinigung wird 1995 Mitglied in der Deutschen Fahrlehrer-Akademie, die damals bereits fünf Jahre besteht (FS 7/95, S. 25). Den von Hamburger Verbandsfahrlehrern überarbeiteten Fahrschüler-Abschluss-Kontroll-Test (FAKT) präsentiert FS 7/95, S. 26. Ab 1.7.95 müssen Fahrschüler in der theoretischen Prüfung auch die richtigen Antworten auf zwölf Fragen zum Thema Drogen wissen (FS 7/95, S. 28). Das Bundesverkehrsministerium erlaubte 1995 den Bundesländern nicht, Versuche mit einer Gebührenordnung zu machen, die die Bundesvereinigung gerne gehabt hätte (FS 9/95, S. 9). Seit 1.8.95 gilt an Bushaltestellen die neue Warnblinkregelung, die bis heute für Verdruss sorgt (FS 9/95, S. 27). Wie sie bei Fahrerlaubnisprüfungen umgesetzt werden sollte, schildern Empfehlungen des Unterausschusses Fahrerlaubnisprüfung in FS 12/95, S. 25. Mit dem leistungsfähigen Lkw-Fahrsimulator von Aitec bricht 1995 eine neue Diskussion um das Reizthema Simulator los (FS 11/95, S. 8). Wie sieht die Fahrausbildung in Europa aus? Diese Frage beantwortet eine Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen, die FS 12/95, S. 10 vorstellt. In FS 12/95, S. 29 schreibt die Bundesvereinigung den Kongress „Mobilität ist Leben“ aus, der im Februar 1996 in Ulm hätte stattfinden sollen. Jahrgang 1996 Zum Jahreswechsel 1995/96 geht Herbert Warnke nach 20 Jahren als Hauptgeschäftsführer des DVR in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Siegfried Werber (FS 2/96, S. 23). Eine erste Diskussion über den Sinn von Vollbremsübungen in der Fahrausbildung beginnt in FS 2/96, S. 35. Am 23.2.96 tritt die Leichtkraftradverordnung in Kraft. Damit ist eine Vorgabe der 2. EG-Führerscheinrichtlinie ins deutsche Recht umgesetzt. Ausbildungs- und Prüfungsfahrzeuge für die Klasse 1b müssen künftig eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von mindestens 100 km/h erreichen, obwohl der Hubraum auf 125 Kubikzentimeter begrenzt ist und die Leistung auf 11 kW/15 PS. Wer die Klasse 3 vor dem 1.4.80 erworben hat, darf die neuen „125er“ ohne Ausbildung und Prüfung fahren (FS 3/96, S. 6). Zum 1.3.96 wird Dietmar Fund Chefredakteur der Zeitschrift (FS 4/96, S. 4). Sein Vorgänger Ralf Schütze wechselt zum Deutschen Sportfernsehen. Seit 6.3.96 ist Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Lenz Präsident der Bundesanstalt für Straßenwesen (FS 4/96, S. 7). Was erfahrene Lkw-Ausbilder mit dem Popometer fühlen, wenn sie im Fahrsimulator sitzen, beschrieb FS 4/96, S. 10. Damals waren 32 Vorstandsmitglieder der Fahrlehrerverbände zu Besuch im Schulungszentrum des Simulator-Entwicklers Aitec. Einen Überblick über die noch wenigen 125er-Leichtkrafträder bringt FS 5/96, S. 10. Wie man am Telefon Preisfragen der Fahrschüler geschickt kontert, zeigt FS 5/96, S. 18. Mit der Eröffnung einer eigenen Akademie droht der Landesverband Bayerischer Fahrlehrer bei seiner Mitgliederversammlung des Jahres 1996. Der Verbandsvorsitzende Gerhard von Bressensdorf wollte damit die Akademien von TÜV und Dekra in der Klasse-2-Ausbildung bremsen. Die Akademie gibt es bis heute nicht (FS 5/96, S. 22). Bei der 96er-Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Hessischen Fahrlehrer wird Heinz Helm zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt (FS 7/96, S. 26). Zum 1.7.96 führt der Verband der Schadensversicherer, wie der heutige Gesamtverband der Versicherungswirtschaft damals hieß, die neue Typklassen-einstufung ein. Die Schadenhäufigkeit der Fahrzeugtypen löst die alte Einteilung nach PS-Klassen ab (FS 7/96, S. 41). Tipps für die richtige Standortplanung (und gegen die unbedachte Einrichtung von Zweigstellen) gibt FS 8/96, S. 8. Zum 1.7.96 tritt eine Übergangsverordnung in Kraft, die die Umschreibung von Führerscheinen regelt, die innerhalb der EU erworben worden sind (FS 8/96, S. 28). Im Sommer 1996 stellen der Deutsche Verkehrssicherheitsrat, die Berufsgenossenschaften und die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände das Programm „Sicher, wirtschaftlich und umweltschonend fahren“ (kurz: SWU-Programm) vor. Fahrlehrer, die außer den beiden Seminarberechtigungen auch einen Ausbildungskurs für das Programm absolviert haben, dürfen Fahrer von Pkw und Transportern ausbilden (FS 8/96, S. 30). Ob ein Sicherheitstraining während der Fahrausbildung sinnvoll ist, versuchte der Vorstand der Bundesvereinigung 1996 bei BMW zu ergründen (FS 9/96, S. 16). Tipps für den Sprung in die Selbstständigkeit gibt FS 10/96, S. 10. FS 11/96, S. 33 schreibt den dritten Pkw-Praxistest aus. Dieses Mal stellt Renault sechs Mégane sechs Monate lang zur Verfügung. Worauf es bei einer Kooperation von Lkw-Ausbildern ankommt, beschreibt FS 12/96, S. 10. Am 1.11.96 passiert die Umsetzung der 2. EG-Führerscheinrichtlinie das Bundeskabinett. Damit beginnt ein Schlussspurt, der sich noch einige Monate hinziehen sollte (FS 12/96, S. 14). Ab März 1997 werden Saisonkennzeichen eingeführt. FS 12/96, S. 26 stellt sie bereits vor. Jahrgang 1997 Die Academy-Gruppe tritt Ende 1996 an Fahrschulen heran, um mit Hilfe bis dato selbstständiger Fahrschulinhaber eine Kette von Fahrschulen zu bilden (FS 1/97, S. 8). Anhand von zuvor eingeholten Erfahrungsberichten von Zweiradfahrlehrern berichtet FS 1/97, S. 32 über Motorradfunksysteme. Wie kann man gute Fahrlehrer als Angestellte halten? Das klärt FS 2/97, S. 8. Über eine Fahrschülerbefragung des Fahrlehrerverbandes Hamburg berichtet FS 2/97, S. 20. Über die Ergebnisse eines Modellversuchs, bei dem Bus-Fahrlehrer Bundeswehrsoldaten ausbildeten, berichtet FS 2/97, S. 26. Wieder einmal sperrte sich die Bundeswehr gegen den Einsatz ziviler Fahrlehrer. Mit welchen Plaketten man trotz Ozon-Alarm weiter fahren darf, zeigt FS 2/97, S. 28. Den ersten Motorrad-Praxistest startet Fahrschule in Heft 2/97, S. 31. Kawasaki stellte drei Modelle des Typs ER 5 drei Monate lang zum Test bereit. Unter Beteiligung der Bundesvereinigung entsteht 1997 der Sammelband „Der Fahrlehrer als Verkehrs-Pädagoge“, herausgegeben von Prof. Bruno Heilig (FS 3/97, S. 21). Es bereitete die Neuregelungen vor, die die Fahrlehrerausbildung wenig später stärker auf die Pädagogik ausrichteten. Der Vorstand der Bundesvereinigung unternimmt 1997 zusammen mit Heiler Software den ersten Anlauf, um ins Internet zu kommen (FS 3/97, S. 26). Was die Motorradreferenten sich beim Fahrschulfunk wünschen, zeigte FS 3/97, S. 37. Zum 15.2.97 kommen 32 neue Fragen für die Mofa-Prüfung (FS 4/97, S. 39). Welche Rechtsformen kommen für kooperationswillige Fahrschulen in Frage und welche steuerlichen Auswirkungen haben sie? Das klärte ein Seminar der Bundesvereinigung (FS 5/97, S. 8). Zusammen mit Dunlop untersucht die Bundesvereinigung, welche Auswirkungen die Einführung der Gefahrbremsung für Fahrschulwagen hätte (FS 5/97, S. 12). Den kommenden Scheckkartenführerschein stellt FS 5/97, S. 14 vor. Im April 1997 bringt der Verlag Heinrich Vogel den ersten FahrlehrerBrief heraus. Mit den beiden Schwerpunkten Pädagogik und Betriebswirtschaft ergänzt er seither die Verbandszeitschrift Fahrschule (FS 5/97, S. 46). Ein Modellversuch mit 40 Bundeswehrsoldaten, die von zivilen Fahrlehrern zum Busfahrer ausgebildet wurden, endet im Frühjahr 1987 mit positiven Ergebnissen, aber ohne klare Aussage des Heeres zugunsten der Fahrlehrer (FS 6/97, S. 16). Am 26.4.97 wird Peter Tschöpe 1. Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg und Nachfolger von Gebhard L. Heiler. An die Stelle des ehemaligen 2. Vorsitzenden rückt Günter Luppart, 3. Vorsitzender wird Jochen Klima (FS 6/97, S. 22). Ebenfalls am 26.4.97 wird Heinrich Haas Vorsitzender des Fahrlehrer-Verbandes Rheinland (FS 6/97, S. 30). Eine Versuchsreihe der Bundesvereinigung bei Dunlop ergibt, dass Gefahrbremsungen in der Fahrausbildung zu keiner nennenswerten Verschleißsteigerung bei Reifen und Fahrwerk führen (FS 7/97, S. 9). Fahrlehrer ärgern sich seit 1997 über die Neuregelung, dass sie die private Nutzung ihres Fahrschulwagens entweder mit einem Prozent des Brutto-Listenpreises monatlich oder nach einem Fahrtenbuch versteuern müssen (FS 7/97, S. 28). Mit einem Verhaltenstraining für Fahranfänger, das über niedrigere Versicherungsprämien attraktiv sein sollte, machen sich im Sommer 1997 TÜV Süddeutschland und HUK Coburg bei der Fahrlehrerschaft unbeliebt (FS 8/97, S. 12). In FS 8/97, S. 15 macht Peter Glowalla erstmals auf die Problematik der komplizierten BE-Regelung aufmerksam. Seit einer Satzungsänderung der Fahrlehrerversicherung am 27.6.97 ersetzt eine Mitgliedervertreterversammlung die Mitgliederversammlung (FS 8/97, S. 18). Mit FS 8/97 wird Birgit Bauer, die bis dahin den Fahrlehrer-Brief aufgebaut hat, stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift. Zum 1.9.87 treten 14 Änderungen der StVO in Kraft, die mit der Radfahrnovelle verbunden sind (FS 8/97, S. 29 und FS 9/97, S. 26). Ab 1.1.98 sind Pkw nur noch prüfungstauglich, wenn sie rechts zwei Türen und am Platz des Prüfers eine Kopfstütze haben (FS 9/97, S. 19). FS 10/97, S. 18 informierte über einen Workshop, mit dem die Deutsche Fahrlehrer-Akademie den Vorstand der Bundesvereinigung über den Stand der Simulatoren-Entwicklung informierte. Ein „Trinkversuch“ mit 500 Fahrschülern startet 1997 in Nordrhein-Westfalen. Das „Pilotprojekt Alkoholprävention bei Fahrschülern und Fahranfängern“ soll innerhalb von zwei Jahren klären, ob die 500 Probanden weniger Alkohol-bedingte Einträge ins Verkehrszentralregister haben als eine gleich große Kontrollgruppe (FS 11/97, S. 26). Jahrgang 1998 Über erste Erfahrungen als Umsetzer des DVR-Programms „Fahr und spar mit Sicherheit – Sicher, wirtschaftlich und umweltfreundlich fahren“ berichten Fahrlehrer in FS 1/98, S. 8. Bei der Vorstandssitzung der Bundesvereinigung im Dezember 1997 präsentiert Arno Wymar den praktischen BE-Anhänger, den er beim Anhängerhersteller Heinemann angeregt hat. Der Anhänger taugt auch zur Mitnahme von zwei Motorrädern; Verbandsmitglieder bekamen einen Nachlass (FS 1/98, S. 14). Hubert Müller berichtete über Nachlässe, die er bei der Reifenkette Holert & Konz für Verbandsmitglieder herausgeholt hat. Bei einem Modellversuch in Nordrhein-Westfalen können Fahrschüler auf Wunsch ihre Theorieprüfung am PC ablegen (FS 2/98, S. 12). Als „Chance voller Risiken“ sieht die Fahrlehrerschaft ein Pilotprojekt in Niedersachsen, bei dem die schulische Verkehrserziehung und die Führer-scheinausbildung verknüpft werden sollten (FS 2/98, S. 14). Für Konfliktstoff sorgte der Umstand, dass die Maßnahme in den Wettbewerb der Fahrlehrer untereinander eingegriffen hätte. Eine Fahrschule, die sich bei der Koblenzer Niederlassung von Mercedes-Benz einmietet, sorgt im Frühjahr 1998 als „Mercedes-Fahrschule“ für Ärger in der Verbandslandschaft (FS 3/98, S. 21). Seit dem 1.4.98 gilt der Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent (FS 3/98, S. 24). Für eine „Schnuppermitgliedschaft“ von Fahrschülern belohnen einzelne ADAC-Gaue 1998 Fahrschulen, die Unterlagen auslegen. Die anfangs einfach auslaufende Mitgliedschaft wird später klammheimlich zur festen Mitgliedschaft umfrisiert, der die Fahrschüler nur durch eine rechtzeitige Kündigung entgehen können (FS 4/98, S. 4). Eine groß angelegte Marktübersicht über Pkw-Anhänger, die sich für die Schulung in der neuen Klasse BE eignen, bringt FS 4/98, S. 8. Nach der Vorstandssitzung am 25./26.02.98 startet der geschäftsführende Vorstand der Bundesvereinigung eine beispiellose Kette von Info-Veranstaltungen. Alle Landesverbände informieren Mitglieder und meist auch Fahrlehrer, die es werden wollten, über die anstehenden Umwälzungen im Fahrerlaubnis- und Fahrlehrerrecht (FS 4/98, S. 14). Über die wichtigsten Änderungen, die die Umsetzung der 2. EG-Führerscheinrichtlinie ins deutsche Recht für Ausbildung und Prüfung bringt, informiert FS 5/98, S. 8. Auf S. 12 folgen die neuen Führerscheinklassen. Am 28. März wechselt das Führungstrio des Fahrlehrerverbandes Thüringen: Gert-Rüdiger Brandes wird 1. Vorsitzender, Olaf Messing 2. und Lothar Stanulewitz 3. Vorsitzender (FS 5/98, S. 28). Im Juli 1998 startet ein Pilotprojekt, das der DVR für Ford entwickelt hat. Eigens zertifizierte Fahrlehrer sollen Ford-Kunden im sparsamen Fahren schulen. Federführend waren die DVR-Mitarbeiter Jochen Lau und Kay Schulte sowie Peter Glowalla (FS 6/98, S. 12). Im Mai 1998 wählen die Mitglieder des Fahrlehrerverbandes Nordrhein Achim Müller zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden und Jos Toman zum 2. Stellvertreter Arno Wymars (FS 6/98, S. 28). Am 19.6.98 verabschiedet der Deutsche Bundestag mehrere Verordnungspakete, die die Umsetzung der 2. EG-Führerscheinrichtlinie ins deutsche Recht regeln. Darüber informiert Dr. Franz-Joachim Jagow, der beim Bundesverkehrsministerium federführend gewesen war, in FS 7/98, S. 10. Die neue Fahrerlaubnisverordnung markiert den Auftakt der „blauen Hefte“ im Format DIN A5, mit denen die Bundesvereinigung ihre Mitglieder topaktuell über die neuen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien informiert (FS 7/98, S. 15). Als Nachfolger des langjährigen 1. stellvertretenden Vorsitzenden Willy Hövener wählen die Mitglieder des Fahrlehrer-Verbandes Westfalen 1998 Hans Plitt (FS7/98, S. 32). Einen weiteren Leser-Praxis-Test startet „Fahrschule“ mit drei Kawasaki Eliminator 125 L (FS 9/98, S. 38). Ältere Motorradfahrer haben durchaus Interesse daran, noch einmal in die Fahrschule zu kommen. Zu diesem Schluss kommen Klasse-1-Fahrlehrer bei einem Erfahrungsaustausch, über den FS 10/98, S. 8 berichtet. Auf der IAA 1998 werben niedersächsische Fahrlehrer für den Berufsstand und den Lkw. Auf einem abgesperrten Gelände durften Pkw-Fahrer ans Steuer mehrerer „Brummis“ (FS 10/98, S. 22). Die zweite Hälfte des Jahres 1998 steht im Zeichen der Übergangsregelungen, die das Auslaufen des alten Rechts am 31.12.98 mit sich bringt (FS 11/98, S. 30). Seit 22.10.98 dürfen manche Pkw-Gespanne Tempo 100 fahren, wenn der Anhänger bestimmte Merkmale erfüllt. Die Erlaubnis gilt aber immer nur für ein bestimmtes Zugfahrzeug (FS 12/98, S. 6). Wie Fahrlehrer die neue Klasse BE ausbilden sollten, zeigen Seminare der Landesverbände (FS 12/98, S. 8). Dass die Fahrausbildung in Europa immer noch extrem unterschiedlich ist, zeigt der Kongress der Europäischen Fahrlehrer-Assoziation (EFA), der im November 1998 in Baden-Baden stattfand (FS 12/98, S. 16). Jahrgang 1999 Über die Unklarheiten der ab 1.1.99 in Kraft tretenden Neuregelungen schwitzte der Vorstand der Bundesvereinigung im Dezember 1999. Kummer machten die offenen Punkte bei der Fahrlehrerausbildung und die Übergangsregelungen für Bus-Ausbilder (FS 1/99, S. 8). Eine neue Ausstattungsrichtlinie für Fahrschulen entrümpelt den Bestand an technischen Modellen (FS 1/99, S. 12). Die Leergewichtsermittlung, die für die komplizierte Klasse-BE-Regelung nötig ist, präzisiert der Bund-Länder-Fachausschuss anders als mancher Pkw-Hersteller (FS 2/99, S. 6). Durch die Vorsteuerkappung und die Ökosteuer müssen Fahrschulen seit Frühjahr 1999 höhere Belastungen tragen (FS 2/99, S. 8). In FS 2/99, S. 16 stellt die Bundesvereinigung die überarbeiteten Diagrammkarten für die Pkw-Ausbildung vor. Audi bekommt zum Jahresbeginn 1999 Ärger mit Fahrlehrern, weil die Ingolstädter die Bezugsbedingungen für Fahrschulwagen verschärfen wollen (FS 2/99, S. 19). Ende Januar 1999 wird Dr. Franz-Joachim Jagow, Ministerialdirigent im Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, in den Ruhestand verabschiedet. Jagow war seit 1985 für das Fahrerlaubniswesen verantwortlich und gilt als „Architekt“ vieler bedeutender Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die das Leben der Fahrlehrer heute prägen. Jagows Amt tritt Regierungsdirektor Christian Weibrecht an (FS 3/99, S. 24). Eignet sich auch ein Unimog als Ausbildungsfahrzeug für die Klasse T? Diese Frage wurde in der Vorstandssitzung der Bundesvereinigung im März 1999 erstmals aufgeworfen (FS 4/99, S. 10). Die Behinderten-Ausbildung ist „Keine Nische für Jedermann“, urteilte FS 5/99, S. 14. Mit Theorieprüfungen im Omnibus wollte der Berliner TÜV der drohenden Prüfungs-Terminnot vor Auslaufen der Übergangsfrist zum 30.6.99 begegnen (FS 5/99, S. 20). Seit April 1999 platziert VW Informationen für Großkunden und Sonderabnehmer wie Fahrschulen im Internet unter der Adresse www.vw-fuhrpark.de (FS 5/99, S. 44). Seit Fahrschüler ihre Fahrstunden gegenzeichnen müssen, bemühen sich viele Softwarehersteller um Programme, die eine elektronische Unterschrift erlauben. Allerdings wird die erst seit Ende 1999 anerkannt, wenn ein Gutachten belegt, das manipulationssicher signiert werden kann (FS 6/99, S. 12). Am 8.5.99 wählt die Mitgliederversammlung des Fahrlehrerverbandes Niedersachsen Gert Fröhling zum 2. und Günter Fieger zum 3. Vorsitzenden (FS 6/99, S. 32). „Nur Profis haben eine Chance“, lautete das Fazit einer groß angelegten Infoveranstaltung des Landesverbandes Bayerischer Fahrlehrer zur Klasse-T-Ausbildung. Organisiert hatten sie der Vorsitzende Gerhard von Bressensdorf und sein „Vize“ Hubert Müller (FS 7/99, S. 8). Seit Mai 1999 hat der Landesverband der Fahrlehrer Saar eine neue Führung: Vorsitzender wurde Winfried Schwaben, sein 1. Stellvertreter Manfred Bard und sein 2. Stellvertreter Manfred Wagner (FS 7/99, S. 22). Am 7.7.99 startet ein weiterer Leser-Praxis-Test mit sieben Kawasaki-Motorrädern des Typs ZR-7 (FS 8/99, S 36). Wie die Ausbildung von Fahrlehreranwärtern aussehen soll, klärt das Bundesverkehrsministerium reichlich spät Mitte Juli 1999 (FS 9/99, S. 12). Der Landesverband Bayerischer Fahrlehrer und der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg kümmern sich mit Seminaren bei den Traktoren-Herstellern Fendt und John Deere intensiv um die richtige Ausbildung von Klasse-T-Fahrlehrern (FS 12/99, S. 14). Am 7.9.99 übergibt Guus Biesenbach, Leiter Produktmanagement Fahrschulen bei DaimlerChrysler, 17 Fahrzeuge des Typs A 170 CDI an 17 der 18 Fahrlehrerverbände. Ein Jahr lang können Verbandsmitglieder von nun an die A-Klasse im Fahrschuleinsatz testen. Alle drei Monate wird das Fahrzeug gegen ein neues getauscht (FS 12/99, S. 30).

